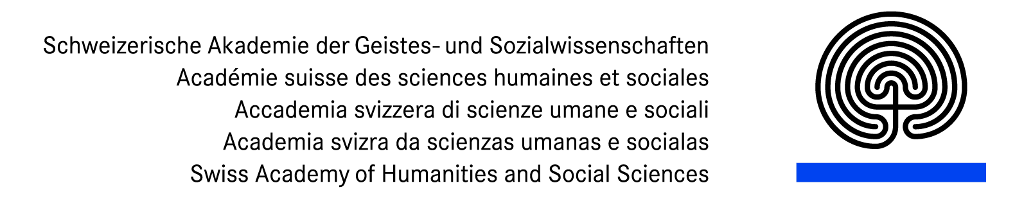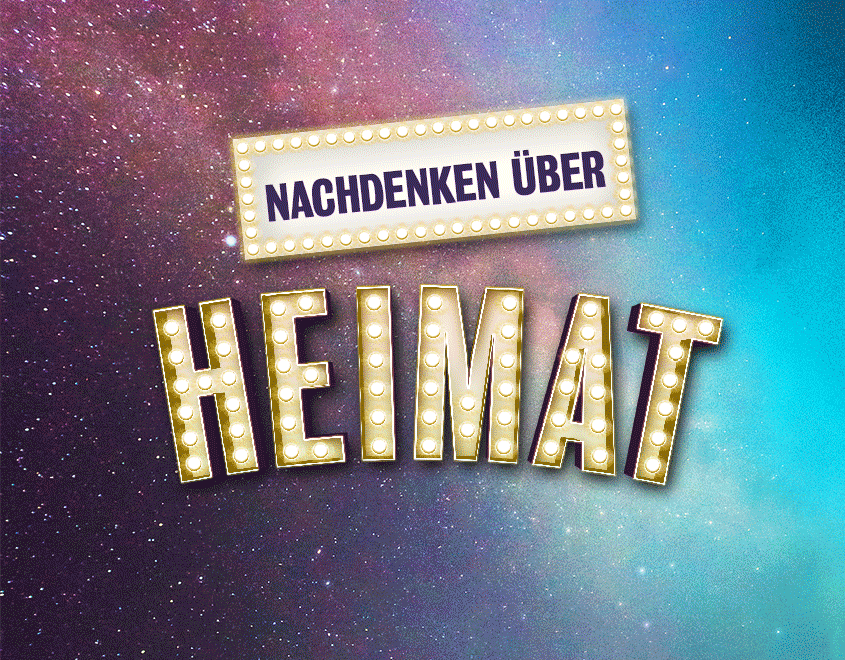„Lasst uns fliehen in die geliebte Heimat!“[1]
I.
Am Anfang der Theorie des Romans – vom ungarischen Philosophen Georg Lukács während des 1. Weltkrieges verfasst – finden sich Zeilen, die mit wohl zu den poetischsten, zauberhaftesten zählen, die über Heimat geschrieben wurden:
„Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhellt. Alles ist neu für sie und dennoch vertraut, abenteuerlich und dennoch Besitz. Die Welt ist weit und doch wie das eigene Haus, denn das Feuer, das in der Seele brennt, ist von derselben Wesensart wie die Sterne.“[2]
Allein, aus dem geschlossenen Weltzustand dieser Ur-Heimat – für Lukács steht hierfür idealtypisch die griechische Antike – sind wir in unserem gegenwärtigen Zeitalter, der Moderne, vertrieben. Wir sind von dem Haus solcher „urbildlichen Heimat“ durch „unheilbare Risse“ getrennt.[3] Zwischen der „Gegenwart des Sinns“, der „reinen Lebensimmanenz“ (lat. immanens = einwohnend) der „abgerundete[n] Welt“ jener seligen Zeiten und uns klaffen die „Abgründe“ einer „unüberbrückbaren Fremdheit“.[4] Das heimische Feuer, das in ihnen brannte, ist erloschen. Und am Firmament leuchten, als unsere „urbildliche Landkarte“, keine Sterne mehr.[5]
Die Moderne ist jene Epoche, in der sich uns eine als Selbstzweck, als Letztes, als Absolutum sinnlich anwesende Heimat entzieht. In der die Signatur dieser Epoche bestimmenden Form des Kapitalismus – ihrer philosophischen Durchdringung widmet Lukács sich fortan – wird das Haus, das wir bewohnen, stattdessen die Ökonomie (gr. oîkos = Haus, Heim): Ein gänzlich reduziertes, von einer jeden lebensweltlichen Einbettung abstrahierendes Haus – nach dem Bilde von Lukács’ frühem Heidelberger Lehrer Max Weber ein „stählernes Gehäuse“.[6] Wo aber die metaphysische Heimat eines letzten, in sich selbst ruhenden Endzwecks entschwindet, da „wird die weltliche Ökonomie im wahrsten Sinne des Wortes unendlich, das heißt end- und zwecklos“.[7] Unter der Herrschaft dieser Ökonomie verkehren sich alle endgültigen Zwecke in bloße Mittel. Hier gilt zuletzt: „Wer keinen Endzweck, hat keine Heimat, kein Heiligtum.“[8]
Unsere allgemeine Seinsform wird unter den Bedingungen der profanierenden, entzaubernden Gewalt der Moderne deshalb, wie Lukács sagt, zur „transzendentalen Heimatlosigkeit“.[9]
II.
Dass aber diese Heimatlosigkeit, nach dem Kantischen Terminus, eine transzendentale ist, besagt auch: Bei genauerem Hinsehen ist erst sie es, die für das moderne Subjekt Heimat überhaupt zu einer möglichen Erfahrung macht.[10] Heimat kann für dieses Subjekt eine Erfahrung nur insofern werden, als sie durch die Krise der Heimatlosigkeit hindurchgegangen ist. Sie ist Heimat nur, sofern sie sich dem Kriterium der Heimatlosigkeit aussetzt. Denn für dieses Subjekt – der junge Hegel nennt es einmal die „Nacht der Welt“ – gibt es, unproblematisch, keinen sinnvollen, in sich geschlossenen Kosmos mehr. In seiner Trennung vom Kosmos sieht es auf ein Unendliches hinaus, welches für diesen „ein Abgrund ist“.[11] Die Möglichkeit von Heimat ist damit notwendig eine prekäre, eine unmögliche: Sie hängt innerlich an der durch die Erfahrung von Heimatlosigkeit markierten kritischen Signatur. Das Skandalon des darin sich zeigenden Risses, das Heimatlos-, das Problematisch-, das Fremd-Gewordensein von Heimat, ist der Maßstab ihrer Wahrheit. Die von diesem Riss angezeigte Unmöglichkeit von Versöhnung ist hier, paradox, der einzige Ort, wo Versöhnung irgend sich ereignen kann.
III.
Angesichts dieses tiefen Problematisch-Gewordenseins vermag Heimat hier anwesend zu sein nur als Gegenstand einer Suche. Heimat und die Suche nach ihr gehören inwendig zusammen. Wo nicht mehr der Sternenhimmel ihre Wege beleuchtet, wird Heimat zu einem unbekannten Land, zur terra incognita. Indem sie sich als dieses Unbekannte der sinnlichen Anschauung entzieht, vermag sie präsent zu werden nur im reflexiven Modus der Sehnsucht nach ihr. Heimat wird deshalb philosophisch. Entsprechend fährt Lukács, Novalis zitierend, fort:
„‚Philosophie ist eigentlich Heimweh [...], der Trieb, überall zu Hause zu sein.’ Deshalb ist Philosophie [...] immer ein Symptom des Risses [...]. Deshalb haben die seligen Zeiten keine Philosophie, oder, was dasselbe besagt, alle Menschen dieser Zeit sind Philosophen, Inhaber des utopischen Ziels jeder Philosophie.“[12]
Mit Fichte, der die Erfahrung dieser reflexiven Sehnsucht in der beginnenden Moderne in aller Konsequenz zum Zentrum seines philosophischen Systems macht, wird Heimat, als gleichsam gegenstandsloser Gegenstand, zum Namen für ein „Sehnen; einen Trieb nach etwas völlig Unbekannten, [...] eine Leere, die Ausfüllung sucht, und nicht andeutet, woher?“.[13] Das Wonach, nach dem sich diese Sehnsucht sehnt, ist nichts dieser Sehnsucht gegenständlich Gegebenes. Es verweist vielmehr auf die Bodenlosigkeit einer in dieser Sehnsucht eröffneten Leere.[14]
Sofern Heimat als unmittelbar-sinnliche Gegenwart nicht gegeben ist, wird sie eben dadurch zur Philosophie als dem – in Einheit von Gegenstand und (Selbst-)Bewusstsein dieses Gegenstands – Inbegriff eines in sich unendlich vermittelten, eines spekulativen Erkennens. Wo Heimat inmitten einer in Ent-äußerung zerrissenen Welt heimatlos geworden ist, wird Philosophie, als Bewegung ihrer Er-innerung im Geiste, zum Ort ihrer Anwesenheit. So heißt es bei Hegel: „Philosophie [ist] eben dies: bei sich zu Hause zu sein, – dass der Mensch in seinem Geiste zu Hause sei, heimatlich bei sich.“[15] Allererst in der Philosophie – als einem in seinem Wahrheitsanspruch von der Welt und allem weltlichen Besitz „abgesonderte[n] Heiligtum“ –[16] vermag Heimat, im Medium begrifflichen Denkens, „ganz gegenwärtig“ zu werden.[17] Nicht als ein weltlicher Besitz, sondern als ein vom Weltlichen Getrenntes: Denn „Heilig-Sein heißt zuerst abgesondert sein.“[18]
IV.
Die griechische Welt dagegen, als von Lukács zitiertes poetisches Inbild urbildlicher Heimat, ist hier unwiederbringlich verloren. Die Sehnsucht, die sich nach der Heimat sehnt, muss sich deshalb ihrer radikalen Gegenstandslosigkeit gänzlich bewusstwerden. Es wäre, so Hegel in dem oben zitierten Passus, bei aller liebenden Sehnsucht zuletzt ein eitles, schlecht-romantisches Unterfangen, sich in der Moderne nach dem Bilde der griechischen Welt zu sehnen.[19] Im Stande ihrer Reflexivität kann Heimat in der Moderne nicht mehr irgendeine partikuläre Identität meinen. Auch nicht die der sittlichen Schönheit der griechischen Lebensform: Denn der in sich geschlossene „Kreis, in dem die Griechen metaphysisch leben, ist kleiner als der unsrige [...]; wir können in einer geschlossenen Welt nicht mehr atmen“ – dieser partikulare Kosmos ist für uns in der Gegenwart seiner plastischen Sinnlichkeit unendlich „gesprengt“.[20]
Wird Heimat angesichts der Weltlosigkeit dieser reflexiven Unendlichkeit indessen vermeintlich unproblematisch „besessen“, wähnt sie sich eines festen Bodens unmittelbar „habhaft“, so ist eben diese Bodenständigkeit Zeichen dafür, dass es sich bei ihr in Wahrheit nur um ein Trugbild von Heimat handelt. Dies gilt auch dann, wenn dieses Trugbild in den identitären Gestalten von angestammtem Besitz, von Nationalismus und Chauvinismus, wo der Name „Heimat“ als Substanz, als Identität angeboten wird, in übermächtiger Weise wirksam wurde und wird. Solche Gestalten bleiben, wie vernichtend sie welthistorisch auch wurden und werden, letztlich nur die hilflosen reaktiven Versuche, den durch die transzendentale Heimatlosigkeit geöffneten Riss zu verdecken: Die trügerische Fülle ihres Bestands vermag die Leere der Heimatlosigkeit und ihre unbedingte „Sehnsucht nach einem kommenden Gott“ nur vordergründig zu schließen.[21] Gerade auch noch die empirisch überwältigende Präsenz solcher Gestalten zeugt, gleichsam als verzerrte Spiegelschrift, nur von der transzendentalen Heimatlosigkeit; das in ihnen sich aufdrängende „Wurzelgefühl“ nur von einer radikalen Wurzellosigkeit, einer Entwurzelung aus allem Bestehenden.[22]
V.
Zugleich heißt diese Auflösung einer jeden substantiellen Identität: Heimat muss hier zu dem werden, was alle Menschen, als Menschen, überall angehen und betreffen kann. Ihre Adressierung wird „universal-menschlich“.[23] Heimat wird zum Inbegriff einer Ordnung, in die nur eintreten kann, wer sich von allen seinen empirischen Prädikaten subtrahiert: Einer Nation oder ethnischen Herkunft, Eigentum und Besitz, einem geographischen Boden oder Territorium, einem sozialen Milieu, einem kulturellen Kontext, einem Stammbaum, einem Familiennamen, einem Pass oder einer ID, einer Tradition, einer Sprache oder, wieso nicht, einem gender oder sex ... Sie entzieht sich allem, was uns an eine bestimmte Identität und deren Eigenschaften bindet. Sie bezeichnet – „heimatlos und außerhalb des Lebens“ – eine Stätte absoluter Eigentumslosigkeit, absoluter Armut an Bestimmungen.[24]
Wer, in der Sprache des Apostel Paulus, bei dem sich im Ausgang der antiken Welt die wesentlichen Weichenstellungen eines solchen Universalismus finden, das Bürgerrecht dieser Heimat hat, dessen Heimat ist „nicht von dieser Welt“: Dessen Heimat bleibt in einer Welt, die sich durch die Zuschreibung von Prädikaten auszeichnet – in Paulus’ Gegenwart, nach seinen Beispielen, etwa „Jude“, „Grieche“, „Sklave“, „Freier“, „Mann“, „Frau“ – rechtlos, expatriiert, heimatlos.[25] Alle, die dieser Heimat angehören, die „haben“, wie Marx und Engels es vom Proletariat sagen – dem Namen, den sie im Innern der aktuellen, der bürgerlichen Gesellschaft dem Subjekt absoluter Eigentumslosigkeit geben –, „kein Vaterland“.[26]
Als Transzendenz, als diese Bewegung eines Transzendierens (auch so lässt sich „transzendental“ lesen) ist Heimat dann kein Ort, den es unmittelbar irgendwo schon gibt. Sie steht gerade dafür, was sich der funktionalen Ordnung alles dessen, was es unmittelbar einfach so gibt, entzieht.
VI.
Heimat vermag eben deshalb aber der Name für den ausgezeichneten Ort utopischer Gegenwart zu sein. Sie steht – wie es bei Lukács’ Jugendfreund, Ernst Bloch heißt – für „etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“.[27]
Nicht nur weist dieser Ort über die Unmittelbarkeit einer mit sich selbst identischen Gegenwart unendlich hinaus. Er bindet auch nicht an etwas zurück, das tatsächlich einmal war. Die Kindheit, von der Bloch spricht, ist nicht unsere empirische Kindheit. Sie fällt aus dem zeitlichen Kontinuum natürlicher Entwicklung heraus: Sie ist eine solche, „worin noch niemand war“. Und – wie bereits nahegelegt: Auch das von Lukács gemalte Bild der griechischen Welt ist kein historisches. Es meint nicht ein faktisches Griechentum. Es lässt, als Projektion, eine Heimat aufscheinen, die niemals war. Noch aber auch ist diese Heimat, im Gegenteil, einfach etwas, das, als reine Zukunft, zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal sein wird. Sie zersprengt vielmehr alles kategorial bloß Tatsächliche. Sie ist weder, in abstrakter Identität, etwas gegenwärtig noch etwas vergangen oder zukünftig Tatsächliches. Ihr Ort wäre vielleicht eher als die Mitte zu denken, welche die drei zeitlichen Dimensionen ineinander verknotet: Als das Paradoxon der gegenwärtigen Wiederholung – Wi(e)der-holung – einer Vergangenheit, der Heimkehr zu einem Ort, die niemals waren, sondern die im Vollzug dieser Wiederholung allererst gewesen sein werden – „so, dass auch hier ein Wiedererinnern, ein sich Zurückfinden in die Heimat wirksam ist, aber eben in eine Heimat, in der man noch niemals war und die dennoch Heimat ist.“[28]
In dieser Konstellation ist Heimat, zugleich und in eins, „gegenwärtig“ und „nichtseiend.[29] Sie ist eine Gegenwart, in der sich Altes und Neues, Ursprung und utopische Zukunft, Erinnerung und Antizipation verschränken. In dieser paradoxen zeitlichen Verknotung führt sie, aus ihrer Heimatlosigkeit heraus, weder einfach zur Vertrautheit unmittelbar gegebener Heimat noch aber auch zur abstrakten Negation hiervon. Vielmehr verschränken und verkehren sich in ihr Vertrautes und Unvertrautes, Bekanntes und Unbekanntes, Nähe und Ferne, Eigenes und Fremdes.[30]
VII.
Heimatlosigkeit deutet – als Nicht-Heimat, als Un-Heimat – gerade auf eine solche Dimension, die diesen Unterscheidungen vorangeht und sie durchquert. Das Un-, das in ihr steckt, ist der logische Index für den unendlichen „Abgrund“, der uns von der Heimat trennt.[31] Und gerade erst in dieser Trennung, im Raum dieses Un- vermag Heimat, vor aller unproblematisch gesicherten Heimat, unser Eigenstes zu werden. Nicht als die Identität eines Bodens, als Besitz – denn als diese ist Heimat endgültig zerbrochen, als diese war sie in Wahrheit nie. Sondern indem sie sich uns als etwas Fremdes ankündigt. Indem sie als ein Abwesendes anwesend wird. Indem sie uns, gleichsam als ein Gespenst, heim-sucht: Als das Gespenst der Heimat...[32] Es ist der Abgrund dieser Bodenlosigkeit, in dem sich, in Analogie zum Freudschen Un-Heimlichen, das Eigene in das Fremde und das Fremde in das Eigene verwandelt und in dem Identität und Nicht-Identität sich verschieben, um so in ein neues Verhältnis zu treten. Das Alte zeigt sich hier nicht einfach als das Bekannte, das es immer schon war, sondern als das Widerfahrnis eines Fremden, das uns, von diesem Augenblick an, immer schon bekannt gewesen sein wird: Denn es ist als die Anwesenheit eines Fremden, „als Geheimnis“, wodurch „das Unheimliche recht eigentlich dem Menschen heimisch“ wird.[33] „Wir schaudern“, so heißt es zu dieser un-heimlichen Verkehrung an einer Stelle bei Novalis, „vor ihnen wie vor Gespenstern und ahnden mit kindlichem Grausen in diesem sonderbaren Gemisch eine geheimnisvolle Welt, die eine alte Bekannte sein dürfte.“[34]
Indem sich das unvordenkliche Alte, die immer schon vertraute und bekannte Nähe, für welche Heimat zunächst steht (zu stehen scheint...), durch den Riss der Heimatlosigkeit hindurch im Un-Bekannten und Un-Vertrauten wiederholt, wird es in dieser paradoxen Wiederholung heimgeholt: Es scheint in ihr auf nicht als die unmittelbare Identität, die es in Wahrheit niemals war, sondern im Vollzug „des totalen Sprungs aus allem Bisherigen heraus“, als Sprung zum Neuen.[35] Heimat wird so zum Ort, aus dessen Perspektive das unvordenkliche Alte – geheimnisvoll entrückt, in gespenstischer Suspension – als das eigentliche, das wirklich Neue wiederkehrt: Als etwas, das (es) nie war – und das (es) zugleich, mit dem Ereignis seiner Ankunft, immer schon gewesen sein wird – das „Sein eines neuen Gottes“.[36]
VIII.
Damit steht der Name Heimat für einen Ort, der, indem er aus allem Gegebenen, aus aller linearen zeitlichen Einordnung herausfällt, als Ort zugleich ein Nicht-Ort, ou-topos, ist. Als diese Utopie bezeichnet Heimat nicht die kompakte, substantielle Fülle irgendeiner Identität. Sie bleibt hier innerhalb der Struktur alles bloß Bestehenden – notwendig – eine Leerstelle.
Aus dieser Leere heraus ist Heimat das, was wesentlich im Kommen ist: Die Ankunft eines Kommenden, worin noch niemand war und worin wir zugleich immer schon gewesen sein werden. Wir haben teil am Ursprung der Heimat nur, indem wir, durch den Riss der Heimatlosigkeit hindurch, auf dem Sprung zu ihr sind. Heimat steht so für etwas, das – als eine eigentümliche Gegenwart, die Aktualität einer aus der Zeit herausfallenden Jetztzeit – uns unbedingt angeht.[37]
Es hat sich gezeigt: Heimat ist in der Moderne, bei Strafe ihrer Unwahrheit, kein substantieller weltlicher Besitz. Sie muss, im Rückgang auf die Philosophie, zum „abgesonderten Heiligtum“ werden. Nur als ein Abgesondertes, in Weltlosigkeit, kann sie hier ihrem Heiligtum gerecht bleiben. Aus der Leere dieser weltlosen Armut heraus aber lässt sie sich von nichts bloß Bestehendem, das sich als dieser Bestand schon Heimat dünkt, vereinnahmen. Als das Heilige ist sie vielmehr die Sprengkraft, die alles um seiner selbst willen Bestehende ins Wanken bringt, um es allererst so heimzuholen: Denn das „Heilige ist die Schrecknis, die das Gefüge der Welt erschüttert.“[38]
Als die Kraft dieses Unbedingten erinnert sie uns daran, dass es, inmitten aller partikularen Situationen, vor allen Dingen, vor allen Bedingungen, darauf ankommt, der Öffnung der von ihr markierten Leerstelle treu zu bleiben. Und wo und wann immer sich, über alle unmittelbar heimatlich-vertrauten Erfahrungen und Gefühle hinaus, der Sprung dieser Öffnung im Bestehenden „gangbare und zu gehende Wege“ bricht, da wird, da ereignet sich die unmögliche Möglichkeit von – Heimat.
[1] Plotin: Enneades I 6, 8, Hamburg 1956-1971.
[2] Georg Lukács: Theorie des Romans: ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik, Hamburg 1963, 21. Die Theorie des Romans erscheint zunächst 1916 in der Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, sodann 1920 in Berlin als Buchform.
[3] Ebd., 25, 29.
[4] Ebd., 25, 26, 25, 22.
[5] Ebd., 21.
[6] Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 1956, 843. –Lukács’ weiterer Denkweg führt ihn 1923 zur Publikation von Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik. Hier wird diese Entfremdung der modernen Welt auf den theoretischen Begriff allesdurchwaltender „Verdinglichung“ gebracht. Von hieraus könnte, m.E. aufschlussreich, kritisch eingewendet werden, dass phänomenologisch-hermeneutische Annäherungen an den Begriff der Heimat den Kern einer solchen radikalen und irreversiblen lebensweltlichen Entfremdung – und einige der implizit damit zusammenhängenden, im Folgenden angedeuteten Konsequenzen – gerade verfehlen.
[7] Giorgo Agamben: Das Geheimnis des Bösen. Benedikt und das Ende der Zeiten, Berlin 2015, 29. – Agamben macht hier, aus Anlass des Pontifikats Benedikts XVI., diese ökonomische Inversion, d.h. dieses zweckrationale Mittel-Werden alles Letzten (gr. éschaton), für ein Denken der Krise unserer Zeit fruchtbar.
[8] Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841, 122. – Dieses Zeitalter ohne Heiligtum nennt Lukács in Anlehnung an Fichte das Zeitalter der „vollendeten Sündhaftigkeit“ (vgl. hierzu Lukács’ Vorwort von 1962 in: Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 12).
[9] Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 52. Ebd., 32 verwendet Lukács den wohl strukturanalogen Ausdruck „transzendentale Obdachlosigkeit“. – Vgl. zum frühen Lukács unter dem Aspekt der Heimat bzw. Heimatlosigkeit etwa: Lee Kishik: Sehnsucht nach Heimat: Zur Entwicklung des Totalitätsbegriffs in den Frühschriften von Georg Lukács, St. Ingbert 1991.
[10] Vgl. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1971, A 11 f., A 845 f. – Den Ausdruck „Heimatlosigkeit“ übernimmt Lukács, im Kontext des Neukantianismus und Neufichteanismus in der Zeit um 1900, wohl Emil Lasks’ Kategorienlehre: Vgl. Emil Lask: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre: Eine Studie über den Herrschaftsbereich der logischen Form, Tübingen 1911, 22 ff., 215 et passim. Lask dürfte hierbei auch ein interessanter Bezugspunkt sein für einen an dieser Stelle sich anbietenden Vergleich zwischen Lukács und Heidegger – wobei Heideggers Denken von Heimat und Heimatlosigkeit freilich, anders als für Lukács, wesentlich auch von Hölderlin geprägt ist. Vgl. für Heidegger etwa: Franco Volpi: „‚Wir Heimatlosen’. Heidegger und die ‚Heimatlosigkeit’ des modernen Menschen“, in: Antonio Pasinato (Hg.): Heimatsuche. Regionale Identität im österreich-italienischen Alpenraum, Würzburg 2004, 175-184.
[11] Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Hamburg 1968, B 111.
[12] Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 20.
[13] Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der Gesamten Wissenschaftslehre, Gesamtausgabe der Bayrischen Akademie der Wissenschaften I, 2, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964 ff., 431.
[14] Auch noch der spätere Fichte hat, wie es anhand seiner politischen Schriften oftmals vorschnell interpretiert wird, keineswegs einen bodenständigen Nationalismus im Sinne: Dessen Haltung identifiziert Fichte in seiner eigenen revolutionären Hoffnung auf eine kommende Heimat vielmehr mit jenen vom Lichte abgewandten „Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge ihr Vaterland anerkennen“ und die so „Bürger des gesunkenen Staates bleiben“ (Johann Gottlieb Fichte: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, 14. Vorlesung, Ausgewählte Werke 6, Darmstadt 1962, 606.
[15] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Theorie-Werkausgabe 18, Frankfurt a.M. 1986, 175.
[16] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Theorie-Werkausgabe 17, a.a.O., 343.
[17] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Theorie-Werkausgabe 8, a.a.O., § 24, Z 2, 85. Vgl. auch: Ders.: Wissenschaft der Logik I, Theorie-Werkausgabe 5, a.a.O., 22.
[18] Jakob Taubes: Abendländische Eschatologie, Bern 1947, 194.
[19] Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, Theorie-Werkausgabe 18, a.a.O., 173-176.
[20] Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 25.
[21] Ebd., 79.
[22] Vgl. zum Begriff des „Wurzelgefühls“: Eduard Spranger: Der Bildungswert der Heimatkunde, Berlin 1923, 11. Von der hierbei geforderten „Totalverbundenheit mit dem Boden“ (ebd.) freilich ist dann der politische „Weg nicht weit zur ‚Blut-und-Boden’-Ideologie“ (Karen Joisten: Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie, Berlin 2003, 56). – Zur genuin faschistischen Struktur einer daraus folgenden Politik siehe insbesondere das Kapitel „Ein Heim für die Heimatlosen“ in: Leo Löwenthal: Falsche Propheten. Studien zum Autoritarismus, Frankfurt a.M. 1982, 98-112.
[23] Vgl. hierzu: Ernst Bloch: Naturrecht und menschliche Würde, Frankfurt a.M. 1961, 27.
[24] Georg Lukács: Die Seele und die Formen: Essays, Berlin 1911, 34.
[25] Phil 3, 20; Gal 3, 28. Beachtung verdient hierbei, dass in der Septuaginta gr. „éthnos“ zumeist für „Heiden“ steht. Ernst Bloch noch sieht so im faschistischen Nationalismus nicht zuletzt auch eine Blasphemie – vgl. hierzu: Manfred Riedel: Tradition und Utopie. Ernst Blochs Philosophie im Licht unserer geschichtlichen Denkerfahrung, Frankfurt a.M. 1994, 73 ff. – Zu Paulus’ Universalismus vgl.: Alain Badiou: Paulus: Die Begründung des Universalismus, München 2002.
[26] Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Marx-Engels-Werke 4, Berlin 1974, 479. – Die universelle Wahrheit des Proletariats liegt für Marx gerade in seinem „Unwesen“, seiner Abstraktion von allen partikularen Bestimmungen – vgl. Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), Marx-Engels-Werke Ergänzungsband 1, a.a.O., 531.
[27] Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, 3, Frankfurt a.M. 1973, 1628. – Vgl. hierzu etwa: Francesca Vidal: „Heimat – Worin noch niemand war?“, in: Bloch-Jahrbuch 2005, Mössingen-Talheim 2005, 122-128.
[28] Ernst Bloch: Geist der Utopie, München 1918, 214. – Als das eigentliche Tempus von Heimat lässt sich damit das futurum exactum bestimmen: Heimat ist konstitutiv das, was gewesen sein wird. Vgl. zu einer möglichen politischen Tragweite dieses Tempus: Alain Badiou: Das Sein und das Ereignis, Berlin 2005, 444-458, 551.
[29] Vgl. hierzu: Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 79. – Volker Schürmann macht diese Vermittlung von Gegenwart und Zukunft anhand von Hegel und Bloch zum Ausgangspunkt seiner Heimat-Konzeption – vgl.: Volker Schürmann: Heitere Gelassenheit. Grundriss einer parteilichen Skepsis, Magdeburg 2002, 177 ff. Dass, wie es hierbei angedeutet wird, gerade Hegels Begriff des Absoluten für diese Perspektive auf „Heimat“ einen systematischen Rahmen darstellen könnte, müsste an anderer Stelle gezeigt werden.
[30] Vgl. hierzu in Bezug auf Novalis: Remo Bodei: Dekompositionen: Formen des modernen Individuums, Stuttgart–Bad Cannstatt 1996, 147: „Nähe und Ferne, Vertrautes und Fremdes, Bekanntes und Unbekanntes [...] bilden umkehrbare Beziehungen in einem offenen System, in dessen Innerem es dem Zeitpfeil frei überlassen ist, die Richtung zu wechseln, sich nämlich die Zukunft eingekapselt in der Vergangenheit und die Vergangenheit unerledigt in der Zukunft (die Zukunft mithin wie eine Vergangenheit, wie ein eschaton, und die Utopie wie eine Regression auf die arche, und umgekehrt) anzuzeigen.“
[31] Logisch lässt sich dieses Un- mit Kants limitativer Urteilsform in Zusammenhang bringen, welche, im Gegensatz zur positiven und zur negativen stehend, von einem Subjekt ein Non-Prädikat aussagt: „A ist Nicht-P“. Vgl. dazu: Immanuel Kant: Logik, in: ders.: Schriften zur Metaphysik und Logik, Werke 5, Darmstadt 1981, 421-582, hier: 534 ff. (§ 22, A 160-162). – Dass die hierbei eröffnete „un-endliche“ Dimension für den modernen Begriff von Subjektivität konstitutiv sei, ist die anregende These von: Slavoj Žižek: Weniger als Nichts. Hegel und der Schatten des dialektischen Materialismus, Berlin 2016, 232 ff. et passim.
[32] Inwiefern die hier skizzierte, an das Kommunistische Manifest (a.a.O., 461) sich anlehnende Figur des Gespensts („das Gespenst des Kommunismus“) als „figure hovering between life and death, presence and absence, and making established certainties vacillate“ (Collin Davis: „État présent. Hauntology, Spectres and Phantoms“, in: French Studies 59, 3 (2005), 373-379, hier: 376) mit Derridas dekonstruktiver „Logik des Gespensts“ (Jacques Derrida: Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt a.M. 2004, 93) in wohl tiefer, doch aufschlussreicher Spannung stehen dürfte, wäre näher auszuführen.
[33] Gunter Hofer: „Geheimnis und Verheimlichung“, in: Confinia Psychiatrica 7 (1964), 234-258, hier: 254.
[34] Novalis: Neue Fragmentensammlung 1798, Schriften 2, Leipzig 1928, 402. – Vgl. dazu und zum Verweis auf Freud: Remo Bodei: Dekompositionen, a.a.O., 147-148.
[35] Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, 1, a.a.O., 233.
[36] Georg Lukács: Theorie des Romans, a.a.O., 76.
[37] „Jetztzeit“ (gr. kairós) ist für Paulus (vgl. Anm. 25) der spezifische zeitliche Modus, vermittels dessen wir, „hier und jetzt“, an der kommenden Heimat teilhaben, indem wir an der Schwelle ihrer Gegenwart (gr. parousía) stehen. Vgl. dazu: Giorgio Agamben: Die Zeit, die bleibt: Ein Kommentar zum Römerbrief, Frankfurt a.M. 2006, 83 ff. et passim.
[38] Jakob Taubes: Abendländische Eschatologie, a.a.O., 194.