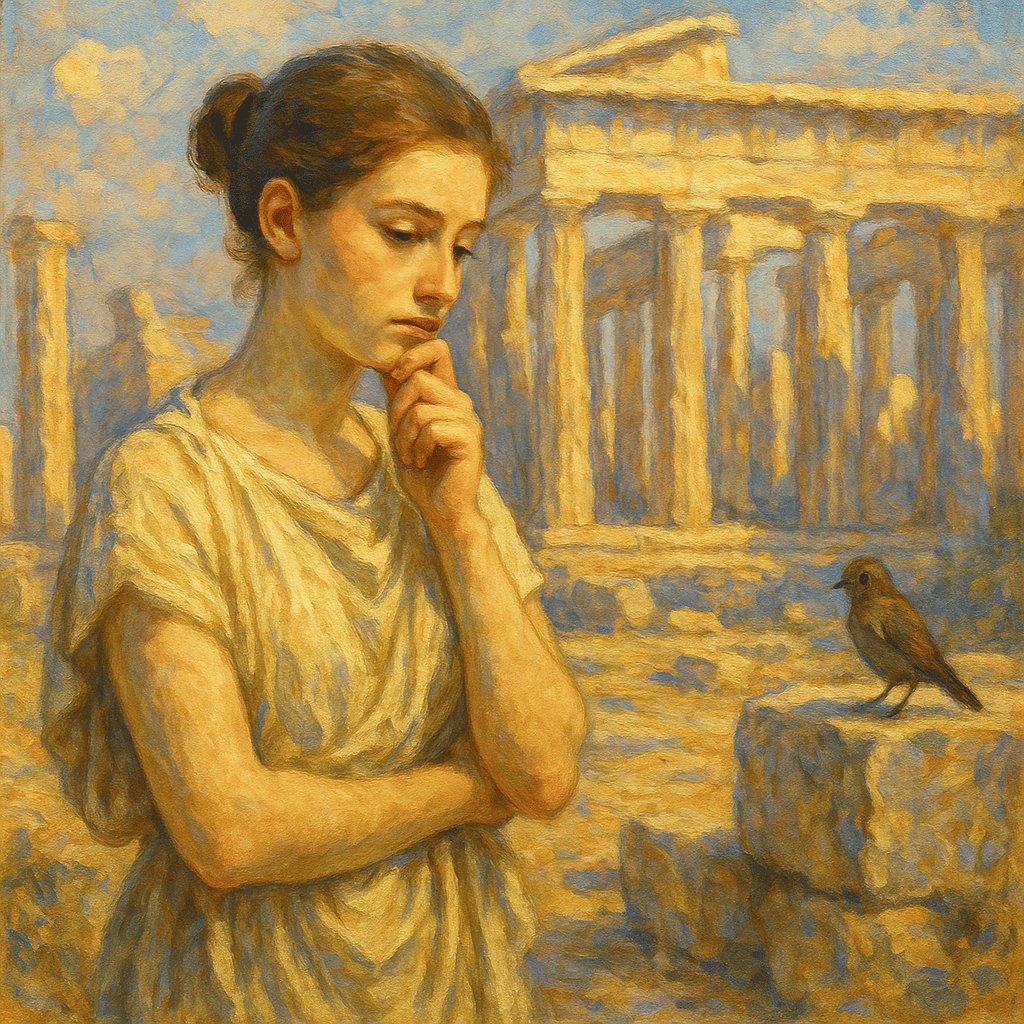Was ist mit der Philosophie passiert? Gibt es sie noch?
Welche grundlegenden Werke hat es in den letzten Jahrzehnten gegeben? An welche zeitgenössischen Philosophen werden sich spätere Generationen erinnern?
Welche neuen Denkwege sind in der Gegenwart eröffnet worden?
Stille –
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese naiv gestellten, doch ernsthaft gemeinten Fragen zu beantworten. Ich werden nun einige von ihnen diskutieren und auf dieser Grundlage dann zu erkunden versuchen, welche Aufgaben die Philosophie heute noch haben kann.
Eine erste Möglichkeit besteht darin, den Impuls dieser Fragen zurückzuweisen.
Wer so fragt, so die Antwortenden, beweist damit nur seine mangelnde Fachkenntnis. Denn nach wie vor geschieht Bedeutendes in der Philosophie, das Spektakuläre ist eben kein Kriterium für seriöse Forschung. Und vom Mangel an Prominenz auf einen Mangel an Kompetenz zu schliessen, ist eine fast schon sträfliche Oberflächlichkeit.
Meine Antwort: Philosophie, welche die Menschen nicht mehr berührt, ist zu etwas anderem geworden. Wenn sie zu einem Glasperlenspiel wird, das unser Denken nicht mehr verändern kann, dann ist sie erstarrt und in gewisser Weise tot.
Ich argumentiere nicht gegen die Fachphilosophen an den Universitäten und anderswo. Was sie leisten, hat sicherlich seine Berechtigung. Aber es entfaltet nur wenig Wirkung. Es dringt nicht ins Volk. Es ist subtil.
Ich argumentiere auch nicht gegen die Fernsehphilosophen. Diese Denker äussern sich zu allem Möglichen (häufig gesellschaftlichen Themen), zumeist eloquent und anregend. Aber auf einer tieferen Ebene schaffen auch sie nicht Neues.
Zweitens lässt sich argumentieren, dass die Philosophie in das Stadium ihrer Reife eingetreten ist. Wir kennen heute auch kaum noch Mathematiker, Chemiker, Biologen oder Physiker. Das bedeutet aber nicht, dass es diese nicht mehr gibt, sondern im Gegenteil: es sind ihrer zu viele. Dass einzelne Wissenschaftler ihre Disziplin nicht mehr dominieren können, weil sie alle anderen überragen, liegt am gestiegenen Niveau, an der höheren Dichte erstklassiger Forscher. Und wenn in manchen Wissenschaften nur noch selten ganz neue Theorien entstehen, liegt das vor allem daran, dass diese Domänen schon gut exploriert und grundsätzlich durchdrungen sind.
Die Philosophie ist nun auch in diese Phase der arbeitsteiligen Saturiertheit eingetreten. Die Fokussierung auf grosse Namen ist damit gar nicht mehr zeitgemäss.
Meine Antwort: Die Philosophie ist – das wird noch genauer auszuführen sein - keine Wissenschaft, auch wenn sie das bisweilen sein möchte. Insofern ist dieser Vergleich schief.
Philosophie ist immer etwas, was uns angeht, sie ist etwas zutiefst Menschliches. Sie ist von der Frage nach Sinn getragen und kann nicht von ihr entkoppelt und in ein arbeitsteiliges Spezialistentum transformiert werden.
Auch inhaltlich ist das Argument nicht überzeugend. Die Wissenschaften stagnieren nicht, sie werden auch nicht irrelevant. Immer wieder ist von Durchbrüchen zu hören, die auch die Boulevardmedien erreichen. Das Kriterium für die Reife einer Disziplin besteht nicht darin, dass sie keine Genies mehr benötigt, sondern dass die Resultate ihrer Tätigkeit für unseren Alltag relevant sind. Und eben das lässt sich bei der Philosophie bestreiten.
Drittens kann man auf die Eigentümlichkeit der Philosophie verweisen. Ihre Entwicklung vollzieht sich nicht kontinuierlich, sondern in Schüben. Die antike Philosophie Griechenlands war eine solche Explosion, auch der Deutsche Idealismus von Kant bis Hegel. Es gibt also Phasen gesteigerter philosophischer Aktivität und andere, wo der Fluss der grossen Gedankenströme ruhiger ist, aber dennoch nicht versiegt.
Ausserdem können wir vielleicht noch gar nicht wissen, welche neuen Denkwege gegenwärtige Philosophen eröffnen. So wurde Nietzsche erst nach seinem Tod zu einer Berühmtheit, auch das Kapital war zu Marx’ Lebenszeiten ein Ladenhüter.
Meine Antwort: Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, die von einem exponentiellen Wachstum an Wissen geprägt ist, in der es auf technologischem Gebiet zu rapiden Fortschritten kommt. Dass ausgerechnet die Philosophie dabei in eine längere Phase der Stagnation zu treten scheint, ist zumindest rätselhaft.
Auch lässt sich bezweifeln, dass sich die Philosophie derzeit einfach in einer ruhigen Phase befindet. Nach Hegels Tod gab es zumindest Epigonen, mit dem Neukantianismus entwickelte sich eine neue philosophische Schule, kurzum, die Philosophie hatte noch einen Puls. Heute hingegen fehlt es der Philosophie nicht nur an echten Stars, sondern auch – und vor allem – an kraftvollen philosophischen Bewegungen, von denen inspirierende Impulse ausgehen.
Viertens endlich kann man den pessimistischen Verdacht bestätigen. Ja, so die resignative Antwort, die Philosophie hat ihre Relevanz weitgehend verloren. Was sie früher an Aufgaben hatte, ist mittlerweile von anderen Institutionen übernommen. Sie hat ihr Potential erschöpft und besteht nun vor allem aufgrund der institutionellen Trägheit weiter.
Jeder kulturelle Bereich hat seine Zeit und erlöscht irgendwann. Wer schreibt heute noch Opern? - die klassische Musik ist insgesamt abgeschlossen. Auch in den Wissenschaften verhält es sich ähnlich: Die klassische Mechanik ist ebenso vollendet wie die klassische Optik.
Letztlich ergeht es der Philosophie wie zuvor der Theologie. Sie wird marginal, weil sie zu allgemein, zu unspezifisch ist. Sie stirbt, weil alles sterben muss, um dem Neuen seinen Platz zu lassen; aber sie lebt in dem fort, was sie hervorgebracht hat. Wie die Vögel in den Dinosauriern.
Dieses Argument ist wohl das interessanteste und eines, dass ich nicht einfach so beantworten kann.
Zunächst gibt es hier einen Spielraum in der Interpretation: Erlöscht die Philosophie, weil sie die ihr zugehörigen Aufgaben gelöst hat oder weil sie an ihnen gescheitert ist?
Oder sind diese Aufgaben nicht mehr relevant (wie manche Probleme der Scholastik)?
Oder sind es dieselben Aufgaben, die aber nun von anderen Disziplinen besser gelöst werden können?
Vor allem aber: Was überhaupt sind die Aufgaben der Philosophie?
Erst, wenn das geklärt ist, lässt sich überhaupt abschätzen, ob es sinnvoll ist, von einem Potential der Philosophie (als Disziplin) zu sprechen und gegebenenfalls, ob dieses sich erschöpft hat.
Ich versuche eine erste Annäherung an diese Frage, indem ich einen Blick auf die Geschichte der (westlichen) Philosophie werfe, insbesondere auf ihre Anfänge.
Wir sehen dabei, dass die Philosophie dabei im Spannungsfeld zwischen zwei Polen steht.
Einerseits will sie die Welt erklären, sie will ihre allgemeinsten Strukturen offenlegen. Sie will ohne Rückgriffe auf dogmatische Behauptungen (mythologischen oder religiösen Typs) auf der Grundlage reiner Rationalität die Beschaffenheit der Realität aufklären. Insofern wird sie zu einer Art von Überwissenschaft oder zu einer Protowissenschaft, der jede bereichsspezifische Selbstbeschränkung fehlt.
Andererseits will sie uns zu einem gelingenden Leben verhelfen. In diesem Fall will sie zwar allgemein, doch auch persönlich sein, sie will eine Philosophie sein, die übernommen, die gelebt wird. Auf dieser Ebene kann Philosophie beratend sein, moralisch, erhebend oder therapeutisch, in jedem Fall zielt sie vor allem auf den Menschen und nicht auf die Welt an sich.
Diese beiden Pole sind auf den ersten Blick sehr verschieden, sodass zunächst nicht unbedingt klar ist, wie sie überhaupt zusammenpassen können.
Auf der einen Seite geht es darum, wie die Welt beschaffen ist, es geht um ihr Sein, es geht darum, was wahr ist.
Auf der anderen Seite dagegen geht es um die Frage, wie wir uns in dieser Welt mit ihren Geschicken verhalten sollen, es geht um das Sollen, es geht darum, was richtig ist.
Diese Spannung des Fokus zwischen den Polen Sein und Sollen charakterisiert die Philosophie von ihren Anfängen an. Soll sie nur erkennen, was ist oder soll sie die Welt verändern? Oder soll sie nicht einmal die Welt verändern, sondern bloss die eigene Haltung ihr gegenüber?
Hier stellt sich nun die Frage, wie die Philosophie die widerstreitenden Anforderungen ihrer beiden Flügel miteinander verknüpft, und zu einer zwar nicht perfekten, doch auch nicht dysfunktionalen Einheit bringt.
Manchmal, so scheint es zumindest, tut sie das gar nicht, sondern schlägt sich ganz unbekümmert auf eine der beiden Seiten.
So waren die altgriechischen Naturphilosophen auf der Suche nach dem Stoff oder dem Prinzip, auf das alle sinnlich wahrnehmbaren Phänomene zurückzuführen sind, sie suchten nach dem Weltgesetz.
In verwandtem Sinne, wenn auch bescheidener geworden, strebten die Mitglieder des Wiener Kreises nach einer objektiven Sprache, die von den Befindlichkeiten der sie nutzenden Subjekte gereinigt ist.
Auf der anderen Seite geht es in der spätantiken Philosophie fast nur noch darum, wie man sein Leben führen soll; diese Fokussierung auf den individuellen Menschen spielt auch später häufig eine zentrale Rolle, sei es als Erlösungssehnsucht in den Pensées von Pascal, oder sei es als ein Werde hart! in der imperativen Philosophie von Nietzsche.
In anderen Fällen, oft bei eher schulmässig orientierten Denkern, sind Natur und Mensch verschiedene Themen, die zu behandeln und in das entstehende System einzuordnen sind. In diesem Sinne sind Naturphilosophie und Ethik zwei Bereiche der Philosophie wie Mechanik und Optik zwei Teile der Physik sind.
Inwiefern hier eine bloss eklektische Verbindung zwischen den beiden philosophischen Polen besteht, oder ob sich da ein tiefer Zusammenhalt zeigt (so bei Kant), lässt sich nicht von vornherein sagen.
Nicht in jedem Fall gibt es eine Trennung zwischen einer Philosophie des Individuums und einer Philosophie der Welt.
Das kann daran liegen, dass eine solche Trennung im Kontext der Weltanschauung gar keinen Sinn ergibt. Wenn etwa ein mittelalterlicher Theologe die göttliche Ordnung erklärt, so hat diese für den Menschen eine unmittelbare Bedeutung. Das Sein der Welt fällt mit ihrem Sollen zusammen und die Einsicht in die Realität Gottes ist von Hingabe an ihn untrennbar.
In anderen Fällen sind Sein und Sollen ursprünglich miteinander verschmolzen, oder sie spiegeln sich ineinander. Wenn Wittgenstein etwa schreibt «worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.» dann ist damit gemeint, dass der tiefste Sinn der Logik gewissermassen ein therapeutischer ist. Und wenn Levinas meint «Die Moral ist nicht ein Zweig der Philosophie, sie ist erste Philosophie.» dann gibt er zu verstehen, dass die Realität schon immer eine moralische ist.
Wie auch immer in konkreten Fällen die Beziehung zwischen diesen beiden Polen aussehen mag, es empfiehlt sich, einen Blick darauf zu werfen, wie die philosophischen Strömungen mit den Entwicklungen zurechtkommen, die sich in der Gesellschaft vollziehen, also insbesondere mit den Fortschritten der Wissenschaft und der zunehmenden Individualisierung.
Wissenschaft entsteht durch die Tätigkeit von Menschen, die sie betreiben.
Diese Fast-Tautologie besagt, dass das Auftreten von Experten zu den Voraussetzungen von Wissenschaft gehört. Experten interessieren sich in ihrem Bereich nur dafür, was andere Experten meinen. Die Gesellschaft teilt sich für sie dabei in wenige Insider und viele Outsider. Was letztere sagen, ist nicht mehr relevant und kann ignoriert werden.
Hiermit ist noch kein hinreichendes Kriterium für Wissenschaft gegeben – auch Fangemeinschaften sind Experten ihrer Idole. Doch der Umstand, dass eine Gruppe von Personen sich über längere Zeit auf eine ähnliche Weise mit einem bestimmten Thema befasst, macht Wissenschaft erst möglich. Es entsteht eine bestimmte Terminologie, es wird entscheidbar, unter welchen Umständen einer Aussage zugestimmt werden kann, es bildet sich ein gemeinsames Wissen heraus, das in der Kommunikation vorausgesetzt werden kann.
Ein zweites Kriterium für die Formierung einer Wissenschaft ist die Herausbildung eines Paradigmas. Unter einem Paradigma kann man eine recht allgemeine, doch materiale Grundüberzeugung verstehen, die geeignet ist, Forschungsprogramme zu stimulieren. Sie sind zwar grundsätzlich - in der Praxis jedoch schwer - widerlegbar und sterben in der Regel mit ihren langjährigen Verfechtern, wenn sie keine neuen Anhänger mehr finden können.
Paradigmen sind dadurch charakterisiert, dass aus ihnen etwas folgt. Und dass aus diesen Folgen wiederum etwas folgt. - Wenn die Erde im Zentrum der Welt steht und die Himmelskörper sich in Kreisen um sie bewegen, dann sind bestimmte astronomische Beobachtungen zu erwarten. Wenn diese nicht erfüllt werden, dann muss die Leitidee angepasst, verfeinert oder aber fallengelassen werden.
Auf der Grundlage eines Paradigmas entsteht also das Gewebe einer Theorie, die nach Zentrum und Peripherie strukturiert ist, die mit Konsistenzproblemen kämpft und sowohl für Anhänger als auch (in geringerem Umfang) für Gegner ein Feld von Arbeitsmöglichkeiten bietet, indem sie ein Set von offenen und strittigen Fragen bereithält.
Wir finden uns bereits auf dem Terrain eines dritten Kriteriums der Wissenschaft. Dieses betrifft die Genauigkeit der Beobachtung, die Quantifizierung der Welt. Die dabei errungene Präzision führt dazu, Diskurse über paradigmatische Probleme zu versachlichen, aus der Sphäre der blossen Meinung herauszuholen. Damit verblasst der Nimbus der Autoritäten und der kanonischen Schriften, die Aufmerksamkeit richtet sich stattdessen auf die Sphäre der Sachen, die Realität selbst wird zum letzten Kriterium für eine Theorie.
Die Steigerung der Genauigkeit, der Menge und der Systematisierung von themenspezifischen Informationen ist deshalb ein Zeichen dafür, dass eine Wissenschaft entsteht. Dem entspricht auch eine Steigerung der Anforderungen an die dabei verwendete Sprache. Es entstehen domänenspezifische Terminologien, die Argumentation orientiert sich streng an der zu behandelnden Sache und den für die Thematik relevanten Fakten.
Damit ist das Feld für ein viertes Kriterium der Wissenschaft eröffnet: die Nachprüfbarkeit. Die Ergebnisse von Wissenschaft müssen nicht nur einsichtig, sondern wiederholbar sein. Wir stossen hier also auf das berühmte Poppersche Merkmal der Falsifizierbarkeit. Eine Theorie, die sich gegen Widerlegung immunisiert, wird ideologisch - wissenschaftlich wird sie dann, wenn sie nicht von sich behauptet, wahr zu sein, sondern mit ihrem ungewissen und vorläufigen Status einverstanden ist.
Oft wird Wissenschaft in diesem Stadium experimentell. Experimente werden durchgeführt, um Ergebnisse einer Theorie zu überprüfen. Das führt notwendigerweise dazu, dass die Theorie selbstreferentiell wird: Sie bezieht sich auf sich selbst. Sie wird damit auch allgemein, denn bestimmte Sachverhalte müssen sich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten herstellen lassen, es werden auf diese Weise Gesetze der Realität entdeckt und bestätigt.
Der Aspekt der Herstellbarkeit führt zu einem fünften und vorläufig letzten Kriterium von Wissenschaft, das ihre Reife, wenn nicht gar ihre tendenzielle Auflösung kennzeichnet. In vielen Fällen wird erfolgreiche Wissenschaft irgendwann kreativ. Sie beschreibt nicht mehr nur die Welt, sondern verändert sie. Sie schafft Neues, indem sie die Entwicklung von Technik stimuliert und so bisher unbekannte Strukturen realisiert.
In diesem Stadium verliert das Kriterium der Wahrheit an Relevanz: Es ist nun vor allem entscheidend, ob etwas funktioniert, ob es gelingt. Die Wissenschaft integriert sich in ihre Praxis und muss mitunter darum ringen, eine hinreichende Distanz zu ihr zu wahren, um weiter auch reine Wissenschaft bleiben zu können.
Zwei weitere Aspekte, die zu allgemein sind, um sich in diesen Prozess der Genese von Wissenschaft einzuordnen, verdienen noch eine kurze Diskussion.
Zunächst ist festzuhalten, dass Wissenschaft typischerweise auf einer Verschriftlichung der Kommunikation beruht. Im Unterschied zur gesprochenen Sprache ist das Geschriebene von seinem Urheber gelöst: diese Abwesenheit des Autors trägt wesentlich zu einer Versachlichung der Bezugnahme bei.
Darüber hinaus ist eine Schrift selbst ein Ding mit zeitlicher Beständigkeit, das einer Sammlung von Schriften hinzugefügt werden kann. Auf diese Weise werden Theorien zu etwas (zum Beispiel in Bibliotheken) Vorfindlichem, das erschlossen, kritisiert und weiterentwickelt werden kann.
Der zweite übergreifende Aspekt von Wissenschaft ist die Reduktion der in ihr eine Rolle spielenden Sinnhorizonte. In wissenschaftlichen Kommunikationen bescheidet man sich, man bleibt bei einem Thema. Es ist nicht mehr von Belang, dass alles mit allem zusammenhängt, stattdessen wird darauf geachtet, die Grenzen der jeweiligen sachlichen Domäne nicht mehr ohne Not zu überschreiten. Insbesondere spielt es in ihr keine Rolle mehr, in welchem Bezug das gewonnene oder das fragliche Wissen zum Leben der Menschen steht.
Die Sinnfrage wird für die Wissenschaft marginal oder sogar über ihre Grenzen geschoben. Stattdessen werden die Theoriekörper selbstreferentiell: Probleme führen zu (Versuchen von) Lösungen, diese wieder zu neuen Problemen.
In welcher Beziehung steht nun die Philosophie zu den hier skizzierten Kriterien für die Wissenschaft?
Gehen wir sie, in der gebotenen Kürze, kurz durch:
Ad 1) Fachphilosophen sehen sich genauso als Experten wie die Graduierten anderer Disziplinen. Es gibt Lehrstühle für Philosophie, Fachbücher, Kongresse – der akademische Betrieb ist etwa zwischen philosophischen und soziologischen Kollegien kaum unterschieden.
Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. In der Wissenschaft ist es kaum kontrovers, dass Nicht-Fachleute aus der kommunikativen Praxis ausgeschlossen werden. Sie haben nicht die Kompetenzen, um etwas Relevantes beitragen zu können.
Auch in der Philosophie gibt es spezifische Problembereiche, die von Experten mit anderen Experten thematisiert werden. Diese Tendenz zur Abschliessung wird zuweilen durch eine esoterische oder eine komplizierende Sprache noch verstärkt.
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Philosophie allen Interessierten offenstehen sollte. Ein philosophischer Diskurs ist grundsätzlich nicht ausschliessend: er ist eine eigentlich menschliche Kommunikationsform, ein fortwährendes Gespräch des Menschen mit sich, über sich, die Welt und seinen Platz in der Welt.
Ad 2) Mit viel gutem Willen kann man Paradigmen der Philosophie erkennen, etwa ein theologisches, ein marxistisches, ein phänomenologisches oder ein sprachphilosophisches Paradigma. Sie haben ihre zentralen Thesen, ihre Forschungsprogramme und ihre Anhänger.
Im Unterschied zu den Paradigmen der Wissenschaft sind ihre Resultate aber kaum widerlegbar. Man behilft sich damit, dass man Widersprüchen und Konsistenzproblemen in den philosophischen Theorien nachspürt, wobei aber, wegen der fehlenden Härte der Bewährungskriterien, eine Inflation von Texten zweifelhafter Relevanz droht.
Ad 3) Der Aspekt der Messung ist der erste, wo sich Wissenschaft von Philosophie scheidet. Wenn ein thematischer Bereich sich zu quantifizieren beginnt, sich auf Daten aufbaut, löst er sich aus der Philosophie.
Warum das so ist, ist eine eigene Frage. Wenn in einem Forschungsbereich Messergebnisse eine Rolle zu spielen beginnen, kommt es zu Tendenzen der Abschliessung von thematischen Domänen. Daten beziehen sich auf andere Daten, es kann nun gerechnet werden. Darüber hinaus implizieren Messungen ein Steigerungsverhältnis, sie verlangen nach anderen Messungen, die umfassender und genauer sind als die bereits vorhandenen.
Die Philosophie reagiert auf diese Tendenzen, indem sie auf Genauigkeit in ihrer Sprache fokussiert. Sie entwickelt Terminologien und verschreibt sich in ihren Argumentationen strengen Kriterien. Sie nimmt für sich in Anspruch, zwar nicht dieselben Aufgaben und auch nicht dieselben Methoden wie die positiven Wissenschaften zu haben, aber nichtsdestotrotz derselben Logik zu folgen (und diese zu reflektieren). Die Logik erlangt dadurch einen seltsamen Status, sie ist nun zugleich der Mathematik und der Philosophie zugeordnet.
Ad 4) Philosophie ist, anders als Wissenschaft, in der Regel nicht falsifizierbar. Ihre Thesen sind – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht durch Experimente überprüfbar. Auch hat eine philosophische Theorie typischerweise genügend Eigenkomplexität, um Angriffen von aussen zu begegnen – notfalls durch Selbstimmunisierung: es ist fast immer möglich, an philosophischen Thesen festzuhalten.
Dennoch ist es möglich, dass philosophische Strömungen danach streben, ihre Problemfelder so kleinteilig und präzise zu definieren, dass sie auf analoge Weise behandelt werden wie in den positiven Wissenschaften.
Ad 5) Philosophie kann niemals zu einer Technologie werden oder eine solche fundieren. Der Zweck einer Technik besteht darin, etwas herzustellen, ihr Reflexionsmodus zielt darauf ab, sowohl das Produzierte also auch den Prozess seiner Produktion zu verbessern. Der Sinn dieser Produktion steht dabei nicht zur Debatte, er bleibt extern. In der Philosophie dagegen ist die Sinnfrage immanent.
Wir können also sagen: Insofern wie eine Wissenschaft (oder etwa eine Kulturproduktion) technisch wird, entfernt sie sich von der Philosophie.
Ad 6) In Bezug auf die Schriftlichkeit gibt es zwar Unterschiede zwischen Philosophie und Wissenschaft, doch auch starke Überschneidungen. Schrift ist hier in jedem Fall fundierend und systembildend. Ohne sie ist weder Philosophie noch Wissenschaft möglich.
Unterschiede ergeben sich in der Weise, wie sie verwendet und wodurch sie jeweils kontrastiert wird.
In der Wissenschaft gibt es keine Autoren (das sind nur Namen), im eigentlichen Sinn nicht einmal Bücher, sondern bloss Texte, die sich zu Theorien verweben. Philosophie dagegen ist ohne Philosophen nicht möglich, der Name des Autors bleibt für die Einheit eines Sinnzusammenhanges konstitutiv.
Weder die Philosophie noch die Wissenschaft sind aber reine Textproduktionen, sie können nur vollständig sein, indem sie auf alternative Operationsmodi zurückgreifen können, an denen die Texte sich bewähren können.
Im Falle der Philosophie ist das der mündliche Diskurs. Wir können uns immer zusammensetzen und zu philosophieren beginnen.
In der Wissenschaft ist das die Exploration der Welt: als Feldforschung, als Experiment, als Konstruktion. Wir sehen also, dass die Weise, auf die die Schriften sich abstützen, verschiedene sind.
Ad 7) Die Sinnfrage bietet wiederum eine klare Unterscheidung zwischen Philosophie und Wissenschaft.
In der Philosophie ist die Frage nach dem Sinn immer präsent und sogar leitend. Es geht nie einfach darum, wie etwas ist, sondern warum es so ist und was das bedeutet.
Dagegen hat die Wissenschaft sich von solchen Reflexionen weitgehend gelöst. Sie findet sich bereits gerechtfertigt und lässt sich von Fragen leiten, die sich in ihrem Korpus selbst finden lassen. Ihr Interesse ist spezifisch, nicht allgemein.
Wir sehen also, dass die Philosophie wohl nie in einem vollen Sinne zu einer Wissenschaft werden kann. In der Regel will sie es auch nicht, doch wenn sie es will, verstrickt sie sich in Widersprüche und scheitert.
Auch die Wissenschaften sind voneinander deutlich unterschieden – etwa im Grad ihrer Verbindung zur Technik - und sie entwickeln sich, sie haben keine abgeschlossenen strukturellen Grenzen.
Entwickelt sich auch die Philosophie?
Natürlich ist unbestritten, dass neue Gedanken formuliert werden, neue geistige Strömungen entstehen. Aber gibt es auch einen Fortschritt in der Philosophie im strengen Sinne?
In der Wissenschaft ist Fortschritt messbar, durch die Anhäufung von gesichertem Wissen, vor allem aber durch ihre Bewährung in der Technik, deren Wesen unmittelbar als Verbesserung gefasst werden kann.
Philosophie ist dagegen dadurch charakterisiert, dass wir noch immer auch die frühesten Klassiker lesen, dass deren Denken gerade nicht überwunden, sondern aktuell bleibt.
Vielleicht können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die Frage nach dem Fortschritt in der Philosophie unentschieden ist, unentschieden im Sinne von unentscheidbar oder irrelevant oder von relativ.
Wir sind in unserem Denken heute weiter als Heraklit und wir sind es auch nicht. Dieses Offenhalten der Antwort wäre dann gerade das, was Philosophie kennzeichnet. Sie scheidet damit zwei Domänen unserer kommunikativen Praxis. Dort, wo es keinen Fortschritt gibt, findet sich die Sphäre der Meinung, wo er sich findet, findet sich Wissenschaft.
Philosophie wäre dann die Kompetenz, sich aus den Fesseln der Subjektivität, der blossen Meinung zu befreien, und sie hätte die innere Tendenz, sich in Wissenschaft zu transformieren.
Kann sie – unter dieser Voraussetzung - sich dauerhaft als etwas Eigenes behaupten?
Machen wir uns nun erneut ein Bild von der Philosophie.
Der philosophische Impuls entsteht individuell, wenn nach einer allgemeinen Gültigkeit von Aussagen gestrebt wird, wenn der Anspruch gestellt wird, nicht mehr nur eine persönliche Meinung zu vertreten.
Diese Lösung vom Subjektiven muss kommunikativ bestätigt werden, um zu gelingen. Um Bestand haben zu können, muss dieses negative Moment sich zu einem positiven wandeln. Die entstehende Philosophie muss also operativ werden, sich einen Inhalt geben.
Dafür stehen ihr drei Richtungen zur Verfügung.
1. Sie kann sich mit der gegebenen Welt beschäftigen und ihre allgemeinen, oft verborgenen Strukturen ergründen. Also nach dem zu suchen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
2. Sie kann sich auch an die Subjektivität zurückwenden und die Frage nach dem Sinn stellen: nicht mehr nach dem individuellen, sondern nach dem Sinn des Lebens überhaupt. Sie kann also nach einer Topologie des Sinnes suchen.
3. Und schliesslich kann sie auf die Weise selbst reflektiert, wie sie zu diesen Ergebnissen kommt, also das Denken zu denken. In diesem selbstreferentiellen Moment wird sie zu Logik, sie wird formal, zu einer Methode.
Die eben skizzierten Momente können im Kontext der Philosophie nie ganz auseinandertreten. Sie bleiben aufeinander bezogen, weil die Frage nach dem Sinn immer leitend bleibt und von der unvermeidlichen Spezialisierung nicht völlig überwuchert werden darf.
Was bedeutet diese Struktur nun im Kontext der Geschichte der Menschheit?
Auf der einen Seite haben wir ein sich ständig erneuerndes Reservoir von Subjekten. Wir können hier von einer stabilen, ungefähr gleichbleibenden Quelle sprechen, auch wenn wir einräumen, dass sich die Zahl der Menschen zuletzt deutlich vermehrt hat.
Am entgegengesetzten Pol der Objektivität, finden wir die Wissenschaften, mit einem zuverlässigen, robusten, neuerdings sogar exponentiellen Wachstum.
Der philosophisch interessierte, nach dem Wesen der Dinge suchende Mensch trifft also auf eine ausdifferenzierte, dynamische und selbstbewusste Wissenschaft, die ihre unbestrittenen Tiefen hat.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob es die Philosophie heute überhaupt noch braucht oder ob es nicht hinreichend ist, sich unmittelbar den Wissenschaften zuzuwenden. Die Philosophie würde nicht ganz verschwinden, aber zu einem Residuum, zu einer gedanklichen und kommunikativen Reflexionsform werden, zu einem Räsonieren, einem Modus zur Entideologisierung aufgeheizter Diskurse, zu einer Küchenphilosophie.
Wir werfen nun einen kurzen Blick auf das Verhältnis der Philosophie zur Wissenschaft in der europäischen Geschichte.
Die Vorsokratiker waren fast reine Naturphilosophen. Sie suchten nach einem Prinzip, das den Phänomenen der Welt zugrunde liegt, nach dem Wesen der Welt. Diese Sinngebung blieb allgemein, sie besass einen hohen Grad an Komplexitätsreduktion, indem sie mitunter alles auf eines zurückführte.
Die ionischen Denker interessierten sich kaum für ein konkretes Studium der Natur (das geschah eher in Ägypten). Ihre Entwürfe wurden auch nicht von einer kaum existierenden Wissenschaft herausgefordert. Dennoch kam es in dieser Epoche zu einer ersten Gabelung von Philosophie und Wissenschaft.
Diese betrifft die Mathematik. Im antiken Griechenland wurden wichtige Grundlagen der Mathematik geschaffen, insbesondere (aber nicht nur) im Bereich der Geometrie. Zunächst jedoch war die Mathematik keine freie wissenschaftliche Disziplin, sondern in den Kontext einer geistigen, gewissermassen philosophischen Strömung eingetaucht, die ihren Ergebnissen eine allgemeine Bedeutung verlieh. In diesem frühen Stadium war die Mathematik die Domäne einer esoterischen Gemeinde – den Pythagoreern – die ihre Bedeutung überhöhte und ihr die für die weitere Entwicklung nötigen Freiheitsgrade beschnitt.
Die Mathematik war also die erste wissenschaftliche Disziplin, die sich aus einem unspezifisch-protophilosophischen Milieu emanzipierte und die Philosophie zwang, ihre Grenzen neu (und enger) zu ziehen.
Im europäischen Mittelalter kam es weder bei den Wissenschaften noch in der Naturphilosophie zu spürbaren Entwicklungen. Eine Wissenschaft im modernen Sinne gab es nicht und es gab wenig Interesse für die Natur.
Das mittelalterliche Denken war theologisch, es ging von einer gottgegebenen Ordnung der Welt aus, einer vollkommenen Ordnung, in der sich alles an seinem Platz befand.
Diese Epoche wird oft als unfruchtbar, sogar als dunkel, charakterisiert, doch sie prägte auch Muster des Denkens, die bis in die Gegenwart hinein auf eine grundsätzliche Weise wirken: die Idee der Unendlichkeit, die Idee des Seins, die Idee der Sinngebung und die methodische Gründlichkeit.
Am Ausgang des Mittelalters schied sich die Astronomie aus dem theologisch-philosophischen Theoriekorpus. Die Menge und die Genauigkeit der Beobachtungen des Himmels hatten eine kritische Schwelle überschritten und versammelten sich in einem ersten herrschenden Paradigma – dem geozentrischen Weltbild. In dieser Phase war die Astronomie noch konform mit der Theologie, was sich änderte, als die Widersprüche des geozentrischen Modells zu einem ersten Paradigmenwechsel führten, der sprichwörtlich gewordenen kopernikanischen Wende.
Die Wissenschaft der Astronomie war nun ans Licht getreten, sie hatte sich befreit und konnte fortan in ihrem eigenen Operationsmodus wirken, ohne sich noch an einer allgemeinen Zuständigkeit der Theologie orientieren zu müssen (und an dieser rückzuversichern).
Die nachmittelalterliche Philosophie musste sich nun neu ausrichten. Sie war nicht mehr für alles zuständig und musste ihre Grenzen neu ziehen. Sie hatte kein Monopol auf die Wahrheit mehr und musste sehen, wie sie mit dem nun entstandenen Konkurrenten im Feld der Welterklärung umgehen sollte.
Schritt für Schritt entstanden neue Wissenschaften.
Die Physik etablierte sich vor allem durch Experimente, was sie zur Entdeckung von spezifischen, nachprüfbaren und dem Rechnen zugänglichen Gesetzen führte.
Die Chemie hatte mit der Alchemie eine bereits viele Jahrhunderte währende Vorgeschichte mit einer zwar untauglichen Theorie, aber einer grundsätzlich entwicklungsfähigen experimentellen Praxis.
Mit der Phlogistontheorie begann sich die Chemie als wissenschaftliche Disziplin zu etablieren, mit der Entdeckung des Sauerstoffes konsolidierte sie dann endgültig ihren neuen Status.
Die Philosophie wurde durch die aufstrebende Wissenschaft befruchtet, sie erwachte zu neuem Leben.
Sie war nun für die Details der Natur nicht mehr zuständig. Diese Beschneidung ihrer Domäne zwang sie zur Selbstreflexion, die Existenz der Wissenschaft wirkte in sie hinein, führte zu Auseinandersetzungen und stimulierte methodische Strenge.
Der Rückzug aus der Natur gab der Philosophie die Möglichkeit, sich auf andere Themen zu konzentrieren, die sie nun neu erschloss: die Struktur des Bewusstseins (Descartes), die Quelle und der Ursprung des Wissens (Descartes, Locke, Hume), die Struktur der realen und der idealen menschlichen Gesellschaft (Machiavelli, Hobbes, Rousseau). Auch abstrakte universale Metaphysiken (Spinoza, Leibniz) entstanden.
Diese Tendenzen kumulierten einerseits in einen radikalen Kritizismus, der die gesamte Sphäre der (wissenschaftlichen) Erfahrung aus dem Horizont der philosophischen Reflexion ausschied (Kant) und andererseits in einem allumfassenden philosophischen System, das den Anspruch hatte, die Wissenschaft im Ganzen in sich aufzunehmen, zu integrieren, und zu verdauen (Hegel).
In der zweiten Hälfte des neunzehnten und erst recht im zwanzigsten Jahrhundert beschleunigte sich die Entwicklung. Mit der Evolutionstheorie fand die Biologie ein streitbares und robustes Paradigma und wurde so endgültig zu einer eigenständigen Wissenschaft.
Aber nicht nur das Lebendige, sondern auch das Gesellschaftliche und schliesslich auch das Geistige wurden zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung: so entstanden die Soziologie, die Psychologie und die Sprachwissenschaft.
Die Philosophie reagierte auf diese Entwicklungen. Sie gab ihr Terrain nicht kampflos preis.
Was auf dem Gebiet der Chemie eher lächerlich wirkte (die Alchemie wurde zu einer höheren Chemie uminterpretiert), erwies sich im Dunstkreis der Biologie schon fruchtbarer. Man setzte der rationalen Biologie eine Lebenskraft entgegen, einen Elan vital, der für die biologische Wissenschaft unerreichbar blieb und von einer Lebensphilosophie untersucht werden konnte.
In anderen Wissenschaften entdeckte die Philosophie für sich spezifische Aufgaben.
In der Mathematik entbrannte ein Grundlagenstreit, es wurde als notwendig erachtet, ihren grundsätzlichen Status zu verstehen. Philosophie sollte also die Fundamente der Mathematik insgesamt freilegen.
In der Physik verlangten die Ergebnisse der Relativitätstheorie und – mehr noch – der Quantenphysik nach einer Deutung, die Philosophie fragte also, was die nackten Formelwelten der physikalischen Theorien bedeuteten.
Noch hoffnungsvoller erschienen die Aussichten in den Sozialwissenschaften. Die philosophische Reflexion der Gesellschaft konnte im Horizont der Gesellschaftswissenschaft verortet werden, deren Spektrum dann ein Kontinuum vom Konkreten (Feldforschung) zum Abstrakten (Gesellschaftsphilosophie) reicht.
Eine besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die Auseinandersetzung der Philosophie mit der Psychologie und mit der Sprachwissenschaft. Hier haben wir es nicht bloss mit einem Rückzug von Zuständigkeit, von Abgrenzung oder Assistenz, sondern mit ernstzunehmenden Versuchen der Philosophie zu tun, selbst zu einer Wissenschaft zu werden.
Die bedeutendste philosophische Reaktion auf die entstehende Disziplin der Psychologie war die Phänomenologie. Sie versteht sich als eine Wissenschaft des Bewusstseins, und zwar nicht des individuellen Bewusstseins, sondern von Bewusstsein überhaupt.
Ihre Methode besteht darin, dass sie Setzungen der natürlichen Einstellung einklammert und in dieser Rückwendung des Bewusstseins auf sich selbst im Modus des reinen Bewusstseins operiert. Nun kann die Erforschung der zutage tretenden Phänomene beginnen. Sie werden als erscheinende Wesen erschaut und anschliessend sprachlich fixiert.
Das Projekt der Etablierung einer Wissenschaft der Phänomenologie scheiterte schon an einem fehlenden Verfahren zur Nachprüfbarkeit der erreichten Ergebnisse. Wenn der eine dieses erschaut und der andere jenes, gibt es im Rahmen der Phänomenologie keine Möglichkeit festzustellen, wer von den beiden recht hat.
Das Ganze wäre nicht so hoffnungslos gewesen, wenn es die von Husserls Phänomenologie vorausgesetzte Sphäre von grundsätzlich sprachunabhängigen Wesen tatsächlich geben würde, eine Seinssphäre, deren Wirksamkeit die Grenze zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven überschreiten und so eine Wissenschaft des allgemeinen Bewusstseins ermöglichen würden.
Die eben gegebene Einschätzung wird von der Philosophiegeschichte bestätigt. Zwar erwies sich die Phänomenologie als sehr inspirierend für eine ganze Generation von Philosophen vor allem aus dem deutschen (Scheler, Heidegger, Gadamer) und dem französischen (Merleau-Ponty, Sartre, Lévinas) Sprachraum, aber es gelang ihr nicht einmal ansatzweise, zu einer Wissenschaft zu werden.
Etwas anders verhält es sich mit der später dominant werdenden analytischen Philosophie. Ihre Ursprünge gehen auf den Versuch der Neopositivisten des Wiener Kreises zurück, eine formale deskriptive Sprache zu schaffen, die von den Unschärfen und Zweideutigkeiten des natürlichen Sprachgebrauches gereinigt ist. Das Scheitern dieses Projektes und der nun erfolgende linguistic turn führte dazu, dass die Philosophie sich nun damit beschäftigte, wie wir tatsächlich Sprache benutzen und mit ihr Bedeutungen realisieren.
Eine solche Schwerpunksetzung kann durchaus Hoffnung auf eine wissenschaftliche Philosophie machen.
Von der Seite der Philosophie her erscheint die Sprache als der ideale Rückzugsort. Wenn wir (zwar nicht ausschliesslich, doch wesentlich) durch die Sprache denken, durch sie Bedeutungen erfassen und Sinngebung realisieren, dann ist die Rückwendung des Denkens auf die Sprache eine Rückwendung des Denkens auf sich selbst, eine Selbstreferenz, die sich sogleich entparadoxiert, weil die Sprache einen Umfang hat, den man zum Thema machen kann.
Von der Seite der Wissenschaft her ist die Sprache eine zu erforschende Domäne, die sich einerseits dokumentiert (vor allem als Schrift) und andererseits fortwährend aktualisiert. Die Frage, wie wir mit der Sprache denken, scheint sich also einer wissenschaftlichen Herangehensweise zu öffnen.
Tatsächlich eröffnete die analytische Philosophie eine neuartige philosophische Herangehensweise. Sie zeigte sich wenig interessiert an den bestehenden Denktraditionen, ganz unbefangen liess sie die grossen Namen der Philosophie beiseite. Stattdessen etablierte sie einen problemgetriebenen Operationsmodus, in deren Themen man sich auf eine ähnliche Weise einarbeiten musste wie in Gebiete der Naturwissenschaft.
Irgendwann reichte es nicht mehr aus, sich mit der Sprache zu beschäftigen, stattdessen musste man sich konkreten Sprachen zuwenden. Die zunehmende Präzision der Analysen machte es also notwendig, zu untersuchen, wie die jeweiligen sprachtheoretischen Strukturen in konkreten Sprachen abgebildet sind - wodurch nun die eigentliche Sprachwissenschaft die Kompetenz der Problemlösung erlangte.
Die analytische Philosophie verlor also die Hoheit über ihre Domäne an die Wissenschaft, das Muster eines thematischen Zuständigkeitsverlustes der Philosophie hatte sich ein letztes Mal wiederholt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Philosophie ihre Kompetenzen hinsichtlich der Erklärung der Beschaffenheit der Welt nahezu vollständig an die Wissenschaft verloren hat.
Trotzdem findet sie für sich noch Aufgaben im Umkreis der Wissenschaften.
Mitunter versucht sie, sich als eine methodische Reflexion anzubieten, als Wissenschafts- oder Erkenntnistheorie. Auch hier verliert sie allerdings an Boden, schon weil der Wahrheitsbegriff in den Wissenschaften an Bedeutung verliert.
Eine andere Möglichkeit ist die Hervorbringung von Weltbildern, die sich für die Seinsregionen und ihr Verhältnis untereinander interessieren. Solche - normalerweise auf den Menschen zugeschnittenen - ontologischen Entwürfe erwecken auch über den Kreis der Fachphilosophen hinaus Interesse, aber sie sind zu grobkörnig, um langfristige, arbeitsteilige Perspektiven für eine Theorieentwicklung zu eröffnen.
Wenn das konkrete Sein zur Sache der Wissenschaft geworden ist und sich das abstrakte Sein als zu wenig ergiebig erweist, kann die Philosophie ihre Aufgabe darin sehen, das Sollen zu ergründen.
Sie wendet sich damit dem Menschen zu, und versucht dabei zu helfen, das individuelle Leben und das Zusammenleben in der Gesellschaft zu gestalten. Die Philosophie wird zu einer Philosophie des Lebens, zu Gesellschaftsphilosophie, zu Ethik.
Auch hier findet sich ein weites Feld von wissenschaftlichen Disziplinen, von Institutionen und Organisationen, die ihr dieses Feld streitig machen. Es gibt die Psychologie, die Erziehungswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Politikwissenschaften, zuverlässig gekoppelt an gesellschaftliche Subsysteme. Wir stützen uns auf ein Netz aus Therapeuten, Pädagogen, Lebens-, Ernährungs-, Sexual- und Karriereberatern, auf politische, gesellschaftliche und ideologische Medien aller Art. Sie alle wollen dazu beitragen, das individuelle und das gesellschaftliche Leben zu verbessern.
Es gibt also ein ganzes Spektrum von Angeboten, um Situierungen zu verstehen, zu analysieren, um Defizite zu benennen, Ziele zu definieren und Wege zu ihrer Erreichung zu finden. Die gesamte Gesellschaft, das Engagement praktisch aller Menschen ist in dieses Streben verwickelt und schafft dabei einen Markt, in dem für jeden etwas dabei ist. Ein sich ständig aktualisierendes ausdifferenziertes und sich weiterentwickelndes System zur bestmöglichen Gestaltung der Zukunft ist in der Gesellschaft also schon am Wirken.
Wozu soll es da auch noch die Philosophie brauchen?
Sie versucht, sich durch ihren Anspruch auf Allgemeinheit zu rechtfertigen. So möchte die Ethik die Moral begründen, also die allgemeinen Regeln für ein gutes Handeln bestimmen.
Ein solcher Ehrgeiz, der gewissermassen kontextunabhängige Regeln zu geben beansprucht, Regeln also die für jeden, in jeder Situation zu jeder Zeit gültig sein sollen, überdehnt unvermeidlich die Horizonte der lebensweltlichen Situiertheit, und doch kann die philosophische Ethik nicht von diesem hohen Ross herunter, ohne ihre Deutungskompetenz an spezifischer operierende Konkurrenten zu verlieren.
Jede Ethik steht vor der Entscheidung, auf welche Komponente von Handlung sie fokussiert: auf die Motivation, die Handlung selbst oder deren Konsequenzen.
Im ersten Fall kommt es zu einer Tugendethik, die viele Freiheitsgrade in ihrem Theoriedesign bietet, sich aber als philosophisch nicht sonderlich ergiebig ist.
Im zweiten Fall entsteht eine deontologische Ethik, die häufig rigorose Züge annimmt und sich als wenig alltagstauglich erweist.
Der dritte Typus, die teleologische Ethik wiederum neigt dazu, sich in Detailfragen zu verstricken und auf diese Weise zu ent-philosophieren.
Es soll hier ebenso wenig gegen die zeitgenössische praktische Philosophie argumentiert werden wie vordem gegen die theoretische.
Ich wollte lediglich ein Relevanzproblem der Philosophie konstatieren.
Auch ein Rückzug in die Logik erweist sich nicht als ein geeigneter Ausweg.
Sich damit zu beschäftigen, wie das Denken sich operationalisiert, mag eine interessante Aufgabe sein, aber das ist weniger als je zuvor eine vorrangige Domäne der Philosophie.
Im gerade angebrochenen Zeitalter der Künstliche Intelligenz, in dem wir Menschen uns berufen fühlen, das Denken in Maschinen zu implementieren, wird Logik, verstanden als die Weise, wie von vorhandenem Wissen aus neues erschlossen werden kann, ist zu einer praktischen Disziplin, zu einem Bündel von Problem, für die – bessere oder schlechtere – Lösungen gefunden werden können.
Diese Bestandsaufnahme war eher entmutigend.
Kann die Philosophie irrelevant werden?
Trotz allem: Nein.
Weil wir Menschen sind. Mensch sein, heisst, sich die Frage nach dem Sinn zu stellen, nach einem Sinn, der über uns hinausweist.
Jeder macht im Laufe seines Lebens Erfahrungen und ordnet sie jeweils in die Gesamtheit der bisherigen ein. Dabei entsteht ein Gewebe organsierter Bedeutungen, das sich fortwährend modifiziert, indem es neue Erlebnisse assimiliert. Mit zunehmendem Alter entstehen in diesem Gefüge immer mehr Zonen relativer Stabilität (oder sogar der Starrheit), was aber zu keinem Zeitpunkt tiefgehende Erschütterungen ausschliesst.
Das Produkt dieses mentalen Verdauungsprozesses - die Lebenserfahrung - ist ein subjektives Objektives. Es beruht auf den persönlichen Erlebnissen und ist damit subjektiv. Gleichzeitig stehen deren Bedeutungen aber auch dem Subjekt gegenüber. Damit ist auch gesagt, dass dieses Netzwerk unserer Erfahrung sich befragen lässt und uns auch antwortet, oft nicht eindeutig, sondern mit einer Serie nuancierter, vielleicht auch widersprüchlicher Hinweise.
Dass wir uns in einem fortwährenden Dialog mit uns selbst befinden, ist jedem bekannt. Das Gefüge unserer Erfahrung reift, indem es immer mehr Beziehungen akkumuliert und im Zuge dieser laufenden Objektivierung zu einer Dezentrierung des Ich führt. Es dreht sich nicht mehr alles um mich.
Das Ich findet sich schliesslich irgendwo in der Peripherie seines eigenen Weltbildes wieder, als kaum noch wahrzunehmender, doch leuchtender Punkt im All. Das Subjekt hat sich seinen Platz im Objektiven zugewiesen.
Ein zweiter wesentlicher Aspekt besteht in den Inkonsistenzen, die das System der Erfahrungen aufweist. Indem es widersprüchliche Antworten gibt, stellt es zwar seine eigene regulatorische Potenz in Frage, führt aber andererseits zu Impulsen, das aktuelle Netzwerk zu reorganisieren.
Die Totalität unserer Lebenserfahrung, das ihr korrespondierende Weltbild kann also als eine Theorie verstanden werden, als eine Theorie, die sich selbst kritisiert und korrigiert, die ins Allgemeine ausgreift und keinen anderen Inhalt als die ganze Welt hat.
Wir sind im Absoluten zuhause und können doch dort nicht verharren.
Dieser Widerspruch – welcher der Widerspruch der Vernunft selbst ist – ist unausrottbar in uns eingeschrieben, und die unversiegbare Quelle der Philosophie.
Was kann aber heute die Aufgabe der Philosophie sein?
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich werde hier einen Vorschlag machen, der anderes nicht ausschliesst, sondern sich als eine Möglichkeit versteht, wie sich in unserer Gegenwart Philosophie betreiben und leben lässt.
Die Aufgabe der Philosophie kann es sein, den Sinn der Zukunft zu verstehen.
Eine solche Idee mag befremden, seltsam erscheinen.
Ist es nicht wichtiger, die Zukunft zu gestalten, anstatt sie bloss zu verstehen?
Um welche Zukunft geht es – um meine persönliche Zukunft, die Zukunft meines Kulturkreises, der Menschheit, der Welt?
Um die nahe, die fernere, die ferne Zukunft?
Sollten wir nicht zunächst unsere Gegenwart verstehen, in der wir ja leben statt einer Zukunft, die erst noch kommen wird?
Geht es hier um eine Prognose der Zukunft? Ist dergleichen möglich und nicht vor allem eine Anmassung der philosophischen Spekulation?
Warum also sollen wir die Zukunft in den Blick nehmen?
Zunächst ist festzuhalten, dass wir das immer schon tun. Wir leben in unseren Sorgen, Hoffnungen und Plänen, wir leben von der Zukunft her, in die wir uns entwerfen. Existenz ist Entwurf.
Die Weise unseres Lebens besteht darin, wie wir dem begegnen, was wir erwarten.
Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und soziale Systeme (z.B. Wirtschaftsunternehmen, politische Parteien, Armeen) orientieren sich an ihrer Zukunft. Sie beobachten ihre Umwelt, produzieren dabei Erwartungen und erarbeiten dann Strategien, um die erwartete Zukunft in ihrem Sinne zu modifizieren.
Die Frage, ob es möglich ist, die Zukunft zu prognostizieren, muss deshalb präzisiert werden.
Jedes sinnbasierte System (Tiere, Menschen, Organisationen, Gesellschaften) operiert in einer systemeigenen Zeit, von der die Zukunft eine unreduzierbare Dimension ist.
Zur Gegebenheitsweise der Zukunft gehört, dass sie noch aussteht.
Prognose ist dabei die Zugangsweise, die auf das Sein der Zukunft zielt (ein paradoxes, sich selbst negierendes Sein, da es zum Wesen der Zukunft gehört, auszustehen, also noch nicht zu sein).
Die jeweilige Gegebenheit der Zukunft ist durch eine Reihe von Modifikatoren beeinflusst.
Zunächst gibt es Modifikatoren der Gewissheit. Die Prognosen unterscheiden sich in dem Grad der Sicherheit, der ihnen zugeschrieben wird. So weiss ich, dass ich in hundert Jahren nicht mehr leben werde, aber abzuschätzen, welches genaue Alter ich erreichen werde, ist eine unsichere Prognose.
Zweitens gibt es Modifikatoren der Bedingtheit. Häufig machen Prognosen sich von Bedingungen abhängig, die ihrerseits nicht sicher sind. Aus diesem Grund präsentieren sich Prognosen gern als Bündel von Szenarien, als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung divergierender Erwartungen.
Neben diesen Modifikatoren des Seins, durch die die Wirklichkeit von Zukunftssetzungen variiert wird, gibt es solche der Relation. Mit ihnen wird nicht die Zukunft in Beziehung zur Gegenwart gesetzt, sondern mit sich selbst relationiert. Es geht dabei darum, wie sich verschiedene Setzungen von Zukunft zueinander verhalten.
Erstens geht es dabei um Modifikatoren der Geltung. Das betrifft die Frage, um wessen Zukunft es geht und welchen Zeitrahmen sie betrifft. Man kann über seine private Zukunft sprechen, über die einer Firma, eines Landes, des Universums insgesamt. Weil jedes Zukunftsbild inhaltliche, zeitliche und räumliche Geltungshorizonte besitzt, können sich verschiedene Entwürfe begegnen, ohne sich an ihren Grenzen zu berühren. Sie betreffen dann Verschiedenes.
Das führt uns zu den Modifikatoren der Verbreitung. Eine Zukunft kann rein persönlich und mit niemandem geteilt sein. Sie kann auch einer bestimmten Gruppe von Menschen gehören, wie es bei Insidergeschäften oder Verschwörungen der Fall ist. Inwiefern ein Zukunftsbild sich über Kommunikation verbreitet, ist aber nicht nur eine Frage der Geheimhaltung, sondern auch auf das Interesse zurückzuführen, auf das es trifft. Es muss auf einen fruchtbaren Boden fallen, wenn es seine Reichweite erhöhen will.
Wir gelangen so zu den Modifikatoren der Strittigkeit. Jedes Zukunftsbild tritt in Beziehung zu anderen, die schon da sind: es ergänzt sie, modifiziert sie, konkretisiert, kritisiert oder negiert sie. Es entsteht also eine Konkurrenzsituation, in der verschiedene Zukünfte um Anerkennung kämpfen und fortwährend aktualisierte und ihrerseits umstrittene) Grade von Plausibilität zugeschrieben bekommen.
Ausserdem gibt es die Modifikatoren der Verantwortung. Prognosen unterscheiden sich grundsätzlich von Behauptungen, weil es einerseits jetzt unmöglich ist, zu entscheiden, ob ich richtig liege, dieser Tag aber kommen wird. Ich muss mich für die Position, die ich heute vertrete, also erst später verantworten. Dieser Verantwortungsmodus variiert nun mit der Spezifität und dem Zeithorizont der gegebenen Prognose. Eine Aussage «In fünfzig Jahren wird das Leben besser sein als heute» bietet so viel Interpretationsspielraum, dass sie praktisch nicht zu falsifizieren ist. Und wenn ich sage «In tausend Jahren wird es keine Menschen mehr geben», dann sage ich etwas, von dem ich weiss, dass man mir nie das Gegenteil wird beweisen können.
Anders verhält es sich mit einer Prognose wie «Morgen wird es regnen». Da wird sich morgen zeigen, ob ich recht hatte oder nicht.
Dieses Beispiel führt uns zu den Modifikatoren der Bedeutung, der Frage, wie wichtig eine gegebene Prognose im System unseres Weltbildes ist. Wenn ich mit der Vorhersage des Wetters falsch lag, werde ich leicht meinen Irrtum eingestehen, bei anderen Fragen dagegen werde eher geneigt sein, Deutungen zu geben, die meine Position retten.
Zuletzt sind die sekundären Modifikatoren zu erwähnen. Damit sind die Gegebenheitsweisen der reflexiven Akte gemeint, mit denen sich auf die Zukunftssetzungen bezogen wird.
Die gegebene Zukunft wird bewertet: sie wird erhoffte, befürchtete, risiko- oder chancenreiche oder schlicht erwartete Zukunft.
Diese Modi der Bedeutung wirken auf den propositionalen Gehalt der Zukunftssetzung zurück. Eine drohende Zukunft wird versucht werden zu verhindern, eine angestrebte Zukunft wird in einen Plan integriert, der eine Gesamtheit von Handlungen leitet.
Die Zukunft ist als ein Spektrum von Szenarien gegeben, in das die sie realisierende Instanz durch seine Aktivität eingreift, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung der enthaltenen Varianten im Sinne der gegebenen Bewertungen zu beeinflussen.
Ein Sonderfall ist die erwartete Zukunft. Deren Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich nicht manipulieren, die erwartete Zukunft ist schlicht gesetzt. Auch sie wirkt handlungsleitend, indem die Gewissheit des Erwarteten uns dahin bringt, uns auf es einzustellen.
Die erwartete Zukunft ist gewissermassen die präpositionale Nulllinie der Zukunftssetzung, auf die alle Modifikatoren sich beziehen.
Sie ist das Sein der Zukunft.
Das Problem hierbei ist, dass eine solche erwartete Zukunft gar nicht gegeben ist, genauer gesagt: sie ist als leer gegeben. Wir erwarten eine Zukunft, aber wir wissen nicht welche. Die Zukunft ist als solche unsicher.
Wir haben Gewissheiten (dass die Sonne morgen aufgehen wird, dass wir sterben werden), aber dieses sind nicht interessant. Dort, wo eine Prognose interessant ist, ist sie unsicher.
Dass eine konkrete Vorhersage der Zukunft unmöglich ist, lässt sich allgemein leicht begründen.
Eine gesicherte und umfassende Prognose setzt zunächst eine vollständige Determiniertheit der Welt voraus. Was durch seine Vergangenheit nicht festgelegt ist, lässt sich auch nicht vorhersagen, weil es seinen eigenen Ursprung hat.
Eine determinierte Welt kann sich nicht entwickeln, sie kann nicht komplexer werden. Eine komplexere Welt ist dadurch charakterisiert, dass sie mehr enthält als eine einfachere, es ist in ihr Neues entstanden. In einer deterministischen Ordnung kann nur das einmal Bestehende immer wieder neu kombiniert werden.
Philosophisch gesehen ist eine deterministische Position möglich, auch wenn sie nicht mehr attraktiv ist (es ist die des mechanischen Materialismus, der letztlich keine anderen Gesetze als die der Physik anerkennt).
Der naturwissenschaftliche Reduktionismus hat seltsame Konsequenzen: Wenn alles vollständig durch seine Vergangenheit determiniert ist, die Vergangenheit in ihm also alles ist, dann ist es an sich selbst gesehen nichts, es hat kein eigenes Sein. Es würde also für sich selbst genommen nichts sein, das einzige reale Sein hätten die Gesetze der Welt, welche alles bestimmen.
Und schliesslich: Jedes System ist weniger komplex als seine Umwelt. Es kann nicht in sich seine Umwelt vollständig abbilden, sondern muss deren Komplexität reduzieren, also eine Repräsentation seiner Umwelt erzeugen. Prognosen werden auf der Basis dieser Repräsentationen geschaffen. Sie liefern ein Zukunftsbild auf der Grundlage dieser reduzierten Komplexität. Selbst wenn die Welt determiniert wäre und die Zukunft bereits feststünde, könnte niemand sie vollständig kennen.
Wir haben nun die philosophische Zukunft erreicht.
Das Paradox der Zukunftssetzung kann so formuliert werden: Obwohl es unmöglich ist, die Zukunft vorherzusagen, sind wir (alle sinnbasierten Systeme) darauf angewiesen, eben dies zu tun. Eine Notwendigkeit wird also von ihrer Unmöglichkeit durchkreuzt.
Die Entparadoxierung dieser Struktur geschieht von der Seite der Notwendigkeit her. Die Unmöglichkeit muss in Möglichkeit überführt werden, ohne die Notwendigkeit dabei aufzugeben. Das ist möglich, wenn Prognose so verstanden wird, dass in ihr nicht eine objektiv seiende zukünftige Welt in all ihren Details verstanden wird, sondern ihr Sinn.
Es geht also darum, dasjenige der erwarteten Zukunft herauszuarbeiten, was in Beziehung zu der prognostizierenden Instanz steht, etwas demzufolge, was sich vergegenwärtigen lässt. Die Prognose bleibt so im Medium des Sinns.
Es muss darauf achtgegeben werden, dass durch diese Relationierung das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird.
Es muss sichergestellt werden, dass die Zukunft ein Gegenstand bleibt, dem gegenüber man sich befindet und nicht zu einem Phantasma wird, das sich nach Belieben manipulieren lässt.
Es muss also sichergestellt werden, dass die zu erwartende Zukunft thematisiert wird und nicht die gewünschte. Wir müssen versuchen, über das argumentativ erzeugte Bild der Zukunft einen Zugang zur Welt zu erhalten, wie sie tatsächlich ist.
Auf diese Weise wird Zukunft zu einem Thema von Philosophie. Das geschieht, wenn die Prognosen sich von den Präferenzen lösen, wenn wir vom subjektiven Meinen weg und zum Allgemeingültigen hinstreben. Der Gegenstand der Forschung ist nun die Zukunft, wie sie sein wird - etwas, was von den Kontingenzen der jeweiligen Situierung frei zu sein beansprucht.
Es ist unbestritten, dass Prognosen zu machen zu den Aufgaben von Wissenschaft gehört. Ganze Disziplinen (Wirtschaftswissenschaften, Meteorologie, Zweige der Statistik, der Psychologie) beschäftigen sich mit Vorhersagen zukünftiger Ereignisse. Grundsätzlich hat beinahe jedes naturwissenschaftliche Gesetz prognostischen Charakter: es beschreibt, wie sich etwas entwickeln wird, wenn bestimmte Anfangsbedingungen vorliegen.
Eine ernsthafte Philosophie, deren Thema die Zukunft ist, ist tendenziell der Wissenschaft nahe. Dass sie dennoch von ihr nicht übernommen werden kann, liegt an der grundsätzlichen Unmöglichkeit einer vollständigen beweisbaren Zukunftsprognose. Man kann immer den Umfang oder den Zeithorizont des Prognostizierten ausweiten, sodass die Wissenschaft mit ihren Mitteln das Thema nicht mehr behandeln kann.
Die Philosophie kann auf diese Weise etwas bleiben, das die Reichweite der Wissenschaft überschreitet. Auch wenn die Wissenschaft Fortschritte macht und dadurch mehr und besser prognostizieren kann, kann die Philosophie sich zurückziehen, ohne dass ihr Domäne kleiner wird: das Unendliche verringert sich nicht, wenn man ein Endliches von ihm abzieht. Auf diese Weise kann die Philosophie ein Horizont von Wissenschaft – und dabei bei sich selbst – bleiben.
Die Konsequenz dieser Konstellation ist, dass die philosophische Prognose allgemein und langfristig ist. Wie allgemein und wie langfristig sie sein sollte, lässt sich wiederum nicht allgemein sagen. Das ist auch eine Entscheidung des jeweiligen Theorieentwurfes. In jedem Fall spielen hier die Grenzziehungen seitens der Wissenschaft eine Rolle. Ihre Sache sind spezifische Prognosen in überschaubaren Zeiträumen.
Weil eine philosophische Prognose im Allgemeinen zuhause, muss sie davon absehen, das Zukünftige in all seinen Einzelheiten zu beschreiben – das ist genauso unmöglich, wie es unnötig ist.
Stattdessen muss sie den Sinn dieser Zukunft erfassen. Sinn kann verstanden werden als die Richtung eines Seins, die Richtung wird hier vom Ort der Prognose aus festgelegt, also von der Gegenwart. Die Erfassung des Sinns der Zukunft korreliert deshalb mit ihrer Relevanz für uns.
Die Frage nach dem Sinn stimuliert also das Streben nach einer Vorhersage der Zukunft.
Grundsätzlich entsteht Sinn als Resultat der Konfrontation des Unendlichen mit dem Endlichen von der Seite des Unendlichen her. Sinnbasierte Systeme sind operativ geschlossen, das heisst, als unendlich angelegt. Gedanken schliessen sich an Gedanken an, es kann keinen letzten Gedanken geben. Dasselbe gilt für Handlungen, Kommunikationen oder andere Typen von Operationen sinnbasierter Systeme. Jede abgeschlossene Operation die Voraussetzung für anschliessende Operationen - ein Ende ist nicht vorgesehen.
Damit ist auch das Bewusstsein charakterisiert. Es hat seine Unterbrechungen (etwa im Schlaf), aber es kann sich sein Ende nicht vergegenwärtigen. Wenn es sich seinen Tod vorstellt, dann stellt es sich wiederum sich vor, wie es seinen Leichnam, in dem es einst wohnte, beobachtet.
Reflektierter Sinn entsteht aus der Konstellation heraus, dass die Gewissheit des Todes in einem System verarbeitet werden muss, das das von seinem Design her gar nicht kann. Die Endlichkeit des Lebens wird zu einem Bewusstsein von der Begrenztheit der eigenen Zeit, es wird notwendig, Entscheidungen so zu treffen, dass damit auch auf etwas verzichtet wird und ihnen damit einen Sinn zu verleihen.
Die Einführung des Endlichen im Unendlichen ist aber zugleich eine Überschreitung des Endlichen. Der Sinn besteht darin, die eigene Endlichkeit aufzuheben, er ist ein Modus seiner Übergabe an andere Träger, er ist eine Überwindung des Todes, ein Medium, das nicht an das private Bewusstsein gebunden bleibt.
Deshalb finden wir den Sinn unseres Lebens etwa in unseren Werken, die auch nach unserem Tode weiterwirken und anderen dienen, oder in unseren Kindern, in denen wir weiterleben.
Die Philosophie fragt nun – gewissermassen kalt – nach der grundsätzlichen Struktur dieser Übergabe von Sinn.
Die Überschreitungsstruktur des Sinnes, sein Vermögen, sich zu verunendlichen, setzt voraus, dass es andere Träger von Sinn gibt, die das eigene Ende überstehen. Sie setzt also voraus, dass andere auf uns folgen, dass es weiterhin Menschen geben wird.
Wenn es aber keine Menschen mehr gäbe, und auch nichts, was uns ähnlich ist, dann hörte auch der Sinn insgesamt auf.
Wenn wir uns also bis in eine Zukunft vorausdenken, in der die Menschheit aufhören würde, dann würde der Horizont des Sinnes abschätzbar, von dem aus die Topologie des Sinnes selbst beleuchtet werden könnte.
Die Philosophie wäre dann ganz bei sich.
Wie aber sollen wir uns dieses Ende der Menschheit konkret vorstellen? Sicherlich ist es abstrakt gesehen unbestritten, dass die Menschheit keinen ewigen Bestand haben wird. Die Sterne werden verlöschen, der Zustand des Universums wird in einen Kältetod münden.
Das Bewusstsein dieser unstrittigen zeitlichen Endlichkeit unserer Gattung stiftet für sich genommen noch keinen Sinn, in seiner Abstraktheit hat es kaum eine Verbindung zu unserer Gegenwart, zu unserer Lebenswelt.
Die Aussage, dass alles, was entsteht, seine Zeit hat, seine Zeit des Aufstieges, der Blüte und des Verfalls, scheint zunächst ähnlich geartet zu sein, aber sie führt auf einen fruchtbareren Boden. Sie konfrontiert uns mit der Idee der Entwicklung.
Man kann die Idee der Entwicklung, insbesondere die einer Höherentwicklung rundheraus ablehnen. Zu sagen, dieses sei höher und jenes primitiver, ist bereits eine Wertung und deshalb subjektiv. Zwar lässt sich der damit verbundene Vorwurf von Willkürlichkeit entkräften, indem man sich stattdessen auf den eher technischen Begriff des Komplexitätswachstums stützt, aber das führt zu neuen Schwierigkeiten. Es müsste zuerst geklärt werden, was wir überhaupt unter Komplexität verstehen und inwiefern der jeweiligen Komplexität von etwas ein Mass zugeordnet werden kann.
Aber auch die Ablehnung des Entwicklungsparadigmas führt – unter der Voraussetzung der Anerkennung der Resultate der Wissenschaft – zu ernsthaften Schwierigkeiten. Schon ein kurzer Blick auf die Geschichte des Universums zeigt, dass jeweils neue Strukturen entstehen, die zumindest voraussetzungsreicher sind als die herkömmlichen. Im frühen Stadium des Kosmos gab es nur molekulare Wolken, dann entstanden Sterne, später Planeten mit Meeren, Gesteinen und Atmosphären. Das führte dann, mindestens auf der Erde, zur Entstehung von Leben, zunächst von Einzellern, dann von Meerzellern, Wirbeltieren, zu Vögeln und Säugetieren. Auch bei den Organisationsformen der menschlichen Gesellschaft gibt es eine Abfolge: von der Steinzeit bis hin zu der von Technologie dominierten Gegenwart. Zu sagen, dass es hier keine unterscheidbaren Entwicklungsstufen gäbe, führt unweigerlich zu einer nivellierenden Theorie, in der für den Begriff der Komplexität kein Platz ist, in der es überhaupt keine Entwicklungen, keinen Aufstieg, keinen Verfall, keine Verbesserungen, keine Katastrophen, sondern bloss Abfolgen von Ereignissen gibt.
Wenn wir, wie ich es tue, von einer allgemeinen Tendenz zur Höherentwicklung in der bisherigen Phase des Universums ausgehen (das muss freilich noch begründet werden), dezentrieren wir notwendigerweise die Position der Menschheit im Gefüge der Welt – auch wenn diese Konsequenz häufig nicht gezogen wird.
Jede Organisationsform von Materie hat so ihr korrespondierendes Komplexitätsspektrum, ihre Position in einer Stufenfolge vom Einfachen zum Entwickelten. Wenn das Universum Strukturen von immer weiterwachsender Komplexität hervorbringt, entstehen zwangsläufig neue Organisationsformen, die im Normalfall auf dem bereits Bestehenden aufgebaut sind, dieses also zur Voraussetzung haben.
Auch die Menschheit als Ganze bildet hier keine Ausnahme (das ist zunächst eine These, die der Plausibilisierung bedarf). Sie kann sich nicht zu beliebiger Komplexität steigern, weil ihrem Strukturtyp (ihrer Organisationsform) ein Spektrum entspricht, das zwar gedehnt, aber nicht unbegrenzt überdehnt werden kann.
Irgendwann entsteht dann etwas, dessen Individuen nicht mehr als Menschen und dessen Ganzes nicht mehr als Menschheit bezeichnet werden kann. Oder aber – und dieser Gedanke ist noch zielführender – es wird eine Organisationsform hervorgebracht, die höher entwickelt ist als der Mensch und seine Gesellschaft, und aufgrund dieser gesteigerten Komplexität ein grösseres Entwicklungspotential entfalten kann.
Die Menschheit wird nun zu einer Form, die von zwei Seiten begrenzt ist.
Nach unten grenzt sie sich vom Tierreich ab, aus dem sie zwar entsprungen, von dem sie aber auch unterschieden ist.
Von oben wird sie nun aber von etwas begrenzt, dass ihr überlegen ist und seinen eigenen Entwicklungsgesetzen folgt.
Diese Einsicht ist von grosser Wichtigkeit. Sie bedeutet nämlich, dass sich die – individuellen oder gesellschaftlichen – Entwürfe unserer Spezies nicht mehr in einem offenen Horizont abspielen, sondern in einer beidseitig begrenzten Zone, die wir nicht überschreiten können. Es wird also in Abrede gestellt, dass wir unbegrenzt Neues hervorbringen können. Das schöpferische Potential der Menschheit ist ebenso begrenzt wie das jeder tierischen Spezies.
Diese grundsätzliche Kritik der Vernunft stellt die Frage nach dem Sinn in einer radikalen Weise. Wenn der Horizont der Zukunft nicht offen ist, sondern diese in gewissen Sinnen schon entschieden ist, wenn die menschliche Seinsweise von irgendeinem, vielleicht nicht mehr fernem Zeitpunkt an, gezwungen ist, das bereits Erschlossene zu wiederholen, anstatt neue Sinnhorizonte zu eröffnen, dann sind wir in einem radikalen Sinne auf uns selbst zurückgeworfen und müssen sehen, wie wir mit dieser begrenzten Perspektive der menschlichen Zukunft umgehen können.
Wir sehen an dieser Stelle, dass es nicht notwendig ist, eine Zukunft zu antizipieren, in der es keine Menschen mehr geben wird. Das Entscheidende ist vielmehr, dass jenseits des fraglichen Horizontes die Menschheit nichts mehr zu einem Fortschritt beitragen kann. Sie ist dann nicht mehr die höchstentwickelte Struktur in unserer Region des Universums, sie sind gewissermassen nicht mehr interessant. Durch die Menschen entsteht dann nichts mehr, was es nicht grundsätzlich vorher schon gab. Sie bringen keine neuen Strukturen gesteigerter Komplexität mehr hervor, sie bewegen sich nun in einem geschlossenen Formenraum einer fortgesetzten Wiederholung.
Neben dem Aspekt des Sinns ist hier auch der Aspekt der Wissenschaft von zentraler Bedeutung. Das ist bereits angeschnitten worden.
Eine Prognose geben ist kein Phantasieren in eine Zukunft hinein, stattdessen muss sie fundiert sein, um glaubwürdig sein zu können. Eine Prognose besteht ja nicht nur aus einem Verbund von Aussagen, der darstellt, wie eine Zukunft sein wird – sie muss auch plausibel machen können, wie eine gegebene Situation sich in eine ihr folgende transformiert. Sie beruht also auf der Analyse eines Ausgangspunktes und der Herausarbeitung der die Entwicklung dominierenden Gesetze. Die eigentliche Prognose im engeren Sinne ist dann grundsätzlich nur noch die Konsequenz der geleisteten theoretischen Vorarbeit, die Ausformulierung (eventuell die Ausschmückung, oder auch die Deutung) der erarbeiteten Theorie.
Dieser Fokus auf die Analyse und vor allem auf die Gesetzmässigkeiten der Entwicklung bringt uns der Wissenschaft nahe. Die Welt zu verstehen, bedeutet in dieser Hinsicht vor allem, die allgemeinen Gesetze der Entwicklung aufzuspüren. Dabei sollte nach bester Möglichkeit alles verwertet werden, was die Wissenschaften herausgefunden haben, wobei auch die laufenden Kontroversen aufmerksam verfolgt werden können.
Alle Tatsachen referenzieren auf Vergangenes und werden in der Gegenwart festgestellt. Die Grundlage der Wissenschaften, das Faktische, beruht also auf Vergangenem. Die Zukunft ist nur der Modus, in dem die entwickelten Hypothesen (also die Resultate der Wissenschaft) getestet werden. Und selbst diese Zukunft ist nur eine vorläufige: eine Vorhersage – auf der Grundlage eines hypothetischen Gesetzes - zu überprüfen bedeutet, eine Zukunft zu einer Vergangenheit zu machen, eine Zeitdauer zu überbrücken.
Wir sehen also, dass eine Theorie, die sich der philosophischen Prognose verschreibt, nicht vor allem über die Zukunft spekuliert, sondern sich mit dem beschäftigt, was war und ist. Indem sie untersucht, wie sich etwas Vergangenes in etwas näher an der Gegenwart Liegendes transformiert hat, versucht sie die innere Logik der Entwicklung zu erkennen und Gesetzmässigkeiten herauszuarbeiten, wodurch eine fundierte Prognose überhaupt erst möglich wird.
Im Unterschied zur wissenschaftlichen Forschung geht es der Philosophie nie bloss um einen gesonderten Bereich der Welt. Auch wenn spezifische Thematisierungen unver-meidlich (und auch wünschenswert) sind, so muss doch immer der Gesamtzusammen-hang erhalten bleiben, die Untersuchung muss also durchgängig von ihrer Motivation, eine allgemeine, umfassende und langfristige Vorhersage der Zukunft zu geben, gespeist sein.
Wir müssen also in die Vergangenheit zurückgehen. Wie weit?
Es ist einleuchtend, dass ein Zukunftsbild, dass über den Menschen hinausreicht, auch vor dem Menschen ansetzen muss. Ansonsten fehlt schon das begriffliche Instrumentarium, um eine solche Überschreitung der Grenzen zu bewältigen. Wenn bei der Begründung der Prognose bei der menschlichen Gesellschaft angesetzt wird, dann bleibt sie auch in deren Horizont und kommt nicht über sie hinaus.
Wie weit zurück soll also unser analytischer Blick reichen?
Es ist rasch einzusehen, dass es hier keine natürliche Grenze gibt. Je weiter wir in der Geschichte des Universums zurückgehen, desto weniger voraussetzungsreich sind die Strukturen, die wir dort antreffen, desto einfacher ist das Universum strukturiert, desto weniger und einfachere die Entwicklung leitende Gesetzmässigkeiten liegen vor.
Es geht, wenn wir die Entwicklung im Ganzen betrachten, also nicht nur darum, wie etwas in etwas anderes, ihm Folgendes überführt wird, sondern auch darum, wie neue Gesetzmässigkeiten aus den bereits bestehenden hervorgehen.
Die Gesetze, welche die Entwicklung in früheren Phasen des Kosmos ausschliesslich bestimmt haben, wirken auch weiterhin. Alles, was später hinzugetreten ist, und die Entwicklung höherer Organisationsformen dominiert, ist häufig eine Spezifizierung von etwas Allgemeinerem. Insofern ist es von Bedeutung, aufgrund welcher Gesetzmässigkeiten sich jeweils Komplexität aufgebaut hat. Ansonsten können wir nicht vollständig verstehen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Wir können uns nicht darauf beschränken, nur einen Ausschnitt des Gegebenen zu berücksichtigen. Je breiter und je tiefer das Feld des Wissens ist, dass wir berücksichtigen, desto besser fundiert, desto weitreichender und zutreffender wird unsere Prognose sein.
Deshalb sollte die zu erstellende Prognose nicht einfach auf einer Analyse der Gegenwart oder einer wie auch immer festgesetzten Epoche der Menschheitsgeschichte beruhen, sondern alles in den Blick nehmen, was für die langfristigen Entwicklungen relevant ist.
In seiner Konsequenz bedeutet das: Um einen grösstmöglichen Horizont für unser Verständnis zu gewinnen, ist es für uns ratsam, bis zum Ursprung unserer Welt zurückzugehen.
Wir haben es hier also mit dem Entwurf einer Philosophie zu tun, die sich vorderhand als un-menschlich präsentiert. Die Menschheit wird in analytischer Hinsicht zu einer Struktur mit einer doppelten Grenze, zu etwas, das seine Zeit und seine Bedeutung, seinen Platz im Universum hat, aber darüber hinaus nichts Besonderes ist.
Die hier entstehende Theorie versucht, den Standpunkt des Universums einzunehmen, den Menschen und seine Gesellschaft von aussen zu betrachten.
Natürlich ist ein solcher Standpunkt des Universums widersprüchlich und genau genommen unsinnig. Aber es ist das, was auch die Wissenschaft tut, zumindest solange sie als Wissenschaft operiert und nicht auf ihre Zwecke reflektiert.
Die Wissenschaft bemüht sich, ganz wie die hier vertretene Philosophie der Prognose um einen objektiven Standpunkt und das ist ein Standpunkt, der nicht Standpunkt eines Menschen, einer Gruppe, einer Gesellschaft ist. Der objektive Standpunkt ist der Blick Gottes, der Standpunkt des Universums, der allem seinen Platz zuweist.
Wir sind nun mit dem Problem der Moral konfrontiert.
Eine Philosophie, welche den Menschen in Klammern setzt, eine solcherart dehumanisierte Philosophie – wozu ist sie gut?
Eine Philosophie, die uns weder trösten, noch motivieren, die uns nicht bessern kann – wozu sollen wir sie brauchen?
Zunächst ist dazu anzumerken, dass eine Theorie, welche wie die hier zu entwerfende, den Horizont der Sinngebung thematisiert, nicht ausserhalb der Reichweite einer Ethik steht.
Freilich können die Implikationen für eine Moral nur sehr indirekte sein. Es kann mit ihr kaum ein Handeln moralisch beurteilt werden. Das rührt schon daher, dass in einer reinen Prognose jede getroffene Entscheidung bereits aufgehoben ist: Was immer wir tun oder nicht tun, ist – ganz wie in Hegels Dialektik – dazu bestimmt, die in der Theorie bestimmte Zukunft hervorzubringen.
Diese negative Bedeutungsgebung (wenn das zukünftige Geschehen bereits feststeht, ist es gewissermassen egal, wie man lebt) ist allerdings nur scheinbar eine Rechtfertigung für alles, nur scheinbar eine Nivellierung des Moralischen.
Die Allgemeinheit der Prognose bietet nur einen letzten Horizont, von dem aus im Rücklauf eine Positionierung des Konkreten erfolgt, die aber ihren Charakter des Allgemeinen nicht vollständig verliert. Die grundsätzliche Aussage der hier vertretenen Theorie ist, dass wir auf lange Sicht nicht frei sind, unsere Zukunft zu gestalten und dass die verschiedenen Lebensgestaltungen insofern gleichwertig sind, als dass jede von ihnen ihren Platz hat in der sich vollziehenden Entwicklung, die einer inneren Logik gehorcht.
Diese Einklammerung des Moralischen innerhalb der Theorie ist wiederum keine Ausserkraftsetzung der Moral. Stattdessen definiert sie eine negative Grenze und öffnet dadurch einen Interpretationsspielraum, in dem jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen kann.
Die Aufgabe unseres Gewissens ist die moralische Selbstbeurteilung unserer selbst. Ihm wird die volle Autonomie zugestanden, indem sich die Theorie aus dem Gebiet der Ethik zurückzieht und auf die Anmassung verzichtet, allgemeine Kriterien für ein gutes Handeln geben zu wollen.
Ausserdem ist festzuhalten, dass der Verzicht auf moralische Urteile nicht die Moralität aufhebt. Moral ist, wie Luhmann feststellte, häufig polemogen. Sie fördert Streit, führt zu sich verhärtenden Standpunkten, die sich verbissen bekämpfen und davon abkommen, sich selbst zu hinterfragen. Eine Philosophie der reinen Prognose verzichtet darauf, eine moralische Bifurkation in die Welt einzuführen und die Menschen damit in die Enge zu treiben. Die meisten der wirklich grossen Verbrechen in der Menschheitsgeschichte wurden im Namen des Guten geführt, gegründet auf die vorgebliche Notwendigkeit, das Böse zu besiegen.
Wenn wir von der Seite des Systems zu der der Methode übergehen, zeigt sich noch eine andere Facette.
Die reine Prognose ist in erster Linie eine Aufgabe, die sich mit ihrer Unmöglichkeit auseinandersetzen muss. Diese Aufgabe bedeutet ein ständiges Ringen um intellektuelle Lauterkeit. Es geht darum, die eigenen Interessen, Vorlieben und Wünsche nicht über die Einsicht in die Gesetzmässigkeiten zu stellen, also nicht die Erkenntnisfähigkeit durch Festhalten an Wunschvorstellungen zu blockieren.
Das Bemühen um die reine Prognose ist also kein defizitärer Modus gegenüber dem Engagement. Sondern er hat auch höchst praktische und existentielle Konsequenzen.
Nehmen wir das Beispiel eines Krieges und den Fall, dass ein dritter Staat eine der beiden sich bekriegenden Seiten unterstützt (z.B. aus moralischen Gründen).
Wer sich weitgehend darauf beschränkt zu bedenken, wie die von ihm favorisierte Seite gewinnen soll, anstatt zu fragen, worauf es realistischerweise hinausläuft, der verfährt nicht nur intellektuell unlauter (indem Analysen durch Wunschvorstellungen verfälscht werden), er blockiert nicht nur seine Einsicht in die Natur der ablaufenden historischen Prozesse (in die geschichtlichen Notwendigkeiten), sondern er wird – unter der Voraussetzung, dass die von ihm favorisierte Seite zu verlieren bestimmt ist – einen Krieg sinnloserweise verlängern und so für den Tod der dabei ums Leben kommenden Menschen mitverantwortlich sein.