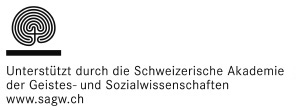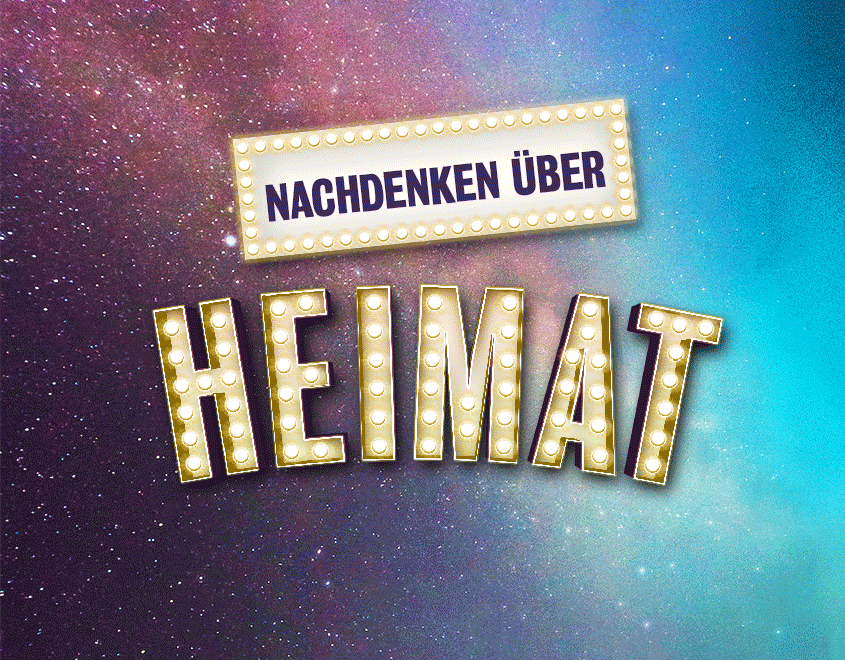I
Auf den ersten Blick scheint nichts einfacher als das Verorten von Heimat. Ihre Koordinaten glaubt man zu kennen, inwendig sogar. Aber dann lesen wir: „[…] wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ So übersetzt Martin Luther Hebräer 13, Vers 14. Johannes Brahms machte daraus in seinem Deutschen Requiem op. 45 die Wendung: „Denn wir haben hie keine bleibende Statt“ – im Sinne von Stätte. Friedrich Hölderlin dichtete in Hyperions Schicksalslied: „Doch uns ist gegeben, / Auf keiner Stätte zu ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings von einer / Stunde zur andern, / Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe geworfen, / Jahr lang ins Ungewisse hinab.“
Bestünde das Heimatliche mithin aus Stätten der Verunsicherung, aus emotional zweifelhaften Orten? Wäre die Heimat somit ein allenfalls unsicherer Kantonist unter unseren persönlichen Identifikatoren, die unsere Identität ausmachen?
Wer immer das Wort ‚Heimat’ gebraucht, es allzu emphatisch im Mund führt, es gar auf seine Fahnen heftet, bleibt demnach gut beraten, diese soeben zitierten Zeilen Hölderlins zu kennen, ja zu verinnerlichen; denn wir stehen offenbar immer mit einem Bein in der „Entheimatung“, der Enthausung und damit der realen wie „transzendentalen Obdachlosigkeit“, um den Begriff von Georg Lukács zu gebrauchen, mit dem dieser treffend die Daseinsverhältnisse in der sogenannten Moderne bezeichnet hat.
Damit ist bereits gesagt, es wird nicht heimatlich-gemütlich zugehen in dieser Rede. Und es wird sich erweisen müssen, welche Art ‚Heiterkeit’ wir aufzubringen haben, um die Räume durchschreiten zu können, von denen Hesse in den Motto-Versen dieser Veranstaltung kündet. Dass auch er und gerade er davon spricht, an keinem dieser Räume wie an einer Heimat zu hängen, klingt wie ein Echo der Zeile aus Hebräer 13 und dem – auch von Brahms vertonten - Schicksalslied.
Und noch einmal Hölderlin: „Will einer wohnen, / So sei es an Treppen, / Und wo ein Häuslein hinabhängt, / Am Wasser halte dich auf.“ – das Prekäre des Wohnens und damit heimatlicher Gefühle spricht sein Fragment ‚Der Adler’ unmittelbar an. Wer wohnen oder sich behausen will, sollte risikobereit sein, nichts für gegeben, gar für selbstverständlich halten. An Stufen finde man seine Bleibe, an ins Wasser hängenden Häusern und Gärten; denn das Wasser spendet Leben und steht zugleich für Übergänge, für das Transitorische, für das Hölderlin einen besonderen Sinn hatte, er, der so genau wusste, dass das Eigene ebenso „gelernt“ werden müsse wie das Fremde, er, der spürte, dass man den Richtungen, die in die Heimat führen, nicht immer über den Weg trauen kann. Denn vielleicht führen sie ja in die Irre.
Hölderlin kannte sich mit der Heimat solchermaßen aus, dass diese sich mit ihm nicht mehr auskannte. Seine große, zwischen Herbst 1799 und Sommer 1800 entstandene „Elegie“ zeugt von einer äußerst ambivalenten Heimat-Kenntnis:
Täglich geh’ ich heraus und such’ ein Anderes immer,
Habe längst sie befragt, alle die Pfade des Lands;
Droben die kühlenden Höhn, die Schatten alle besuch’ ich,
Und die Quellen; hinauf irret der Geist und hinab,
Ruh’ erbittend; so flieht das getroffene Wild in die Wälder,
Wo es um Mittag sonst sicher im Dunkel geruht;
Aber nimmer erquickt sein grünes Lager das Herz ihm
Wieder und schlummerlos treibt es der Stachel umher.
Nicht die Wärme des Lichts und nicht die Kühle der Nacht hilft
Und in Wogen des Stroms taucht es die Wunden umsonst.
Die „Pfade des Lands“ – sie geben keine Antwort mehr. Dieses in der Heimat heimatlos werdende, weil an ihr krankende, zutiefst unruhige Ich sieht sich als verwundetes Wild, auf das in den heimatlichen Wäldern nur noch das Verenden wartet. Die hier geschlagenen Wunden können nicht mehr verheilen.
Wir wiederum wissen: Eine Heimat, die uns nicht auf die Fremde vorbereitet, indem sie das Fremde in sich aufnimmt und es verwandelnd als Wert begreift, bliebe ein Missverständnis. ‚Heimat’ stiftet weniger ‚Identität’, als dass sie Verwandlungen des vermeintlich Eigenen ermöglicht. ‚Heimat’ sollte damit als eine Ermöglicherin angesehen werden. Oder verhindert sie eher die freie Entfaltung des Eigenen, weil sie belastet mit ihren Konventionen und Eigenheiten, die manche jedoch für stabilisierende Lebenswerte halten?
II
Wenn man über die Heimat reflektiert, dauert es meist nicht lange, bis man in Thesen spricht: Heimat ist das und jenes. Warum verhält sich das so? Womöglich deshalb, weil wir über die Bestimmung dessen, was Heimat sei, Selbstbestimmung zu betreiben versuchen.
Aber neben das Thesenhafte tritt alsbald das Fragen: In welcher Beziehung stehen wir zum Gebiet unserer Herkunft? Verstehen wir es als ein Natur- oder Seelenschutzgebiet?
Welche Seinsqualitäten enthält ‚Heimat’ nach unserem Verständnis? Bekennen wir es nur: ‚Heimat’ ist das, was einen verfolgt, zeitlebens. Als Vertreibende kann sie Täterin sein. Heimat begütigt und beunruhigt. ‚Heimat’ ist eine Verwundung, kaschiert als Muttermal.
Wer glaubt, sich in der Heimat auszukennen, verkennt sie. Das Anheimelnde an der Heimat ist eine Sinnestäuschung. Wir haben freilich die Pflicht, das Reden über Heimat dem Gerede einer Pseudoideologie, dem Ordinären am populistischen Gebaren zu entwinden.
Statt des pseudoideologischen Insistierens auf einer heimatgebundenen Identität gilt es sich auf Transidentitäten hin zu entwickeln – die eigene Transität zu entdecken. Das Transitäre in uns. Und noch einmal sei es gesagt: Hölderlins Einsicht, dass das Eigene genau so gut gelernt sein müsse wie das Fremde, ist ein existentiell-pädagogischer Imperativ von unverminderter Bedeutung für uns heute.
‚Heimat’ darf als ein Psychotopos gelten, den es immer wieder neu zu kartographieren gilt.
‚Heimat’ scheint das nach außen gewendete Innere der eigenen Grundbefindlichkeit zu sein; nicht selten gleicht sie dabei unserem Zerrspiegel.
‚Heimat’ verstehen wir nicht selten sich als eine Fülle von Erzählungen – am Rande der Mythisierung. Diese Erzählungen sind in erster Linie Selbstverständigungen. ‚Heimat’ ist damit aber auch Gegenstand von Selbstbelügungen. Von der Heimat erzählend, werden wir zu ‚Autopseusten’ im Sinne Friedrich Schlegels, also zu Selbsttäuschern, täuschen wir uns doch nicht gerade selten über die wahren Verhältnisse in der Heimat hinweg, auch über unser Verhältnis zu ihr; denn ‚Heimat’ erweist sich vor allem immer auch als eines – als Objekt der Verklärung.
Fragen wir weiter: Ist unser wieder und wieder aufkeimendes Interesse an der Herkunft verständlich oder bizarr – denn ein zu genaues Wissen über die Herkunft verstört nicht selten, verunsichert anstatt uns innerlich zu festigen. Unschärfen sind es, die wir im Blick haben, wenn wir das Heimathafte unserer Herkunft bestimmen wollen. Das Verwischen der Spuren, die zurück zur Heimat führen.
Verwirkt man das Recht, über Heimat zu sprechen, wenn man sie verlassen hat? Wie glaubwürdig kann man sein, wenn man auch nur einen Satz über seine sogenannte Heimat sagt, wenn man sie hinter sich gelassen hat, sagen wir vor über dreieinhalb Jahrzehnten? Oder hat man sie in sich verwandelt und spricht beständig über dieses Verwandelte als Heimat? Denn: hat man das je, seine Heimat zurückgelassen? Reist sie nicht beständig mit einem – durchaus auch als schweres Gepäck, als Irritation? Oder sollen wir uns auf die Utopie der Herkunftslosigkeit hinbewegen? Dass in unseren Tagen eine britische Premierministerin ungestraft Kosmopoliten unter Generalverdacht stellen und sie quasi als vaterlandslose Gesellen abqualifizieren konnte, sollte in diesem Zusammenhang besonders zu denken geben. Im Originalton: ‚People without a nation are untrustworthy’.
Wurden nicht Heine und Chopin im Pariser Exil erst wirklich zu einem Deutschen oder Polen, aber eben gleichzeitig zu europäischen Künstlern? Das Leiden im Exil – auch dem simulierten – Thomas Manns Verzweifeln an Deutschland, Vladimir Nabokovs Irrewerden an Russland und Victor Hugos Bitterkeit gegenüber Frankreich: Heimat und Exil, man kann sie nur komplementär nennen und behandeln. Als Stefan Zweig über dieses Verhältnis nachdachte, in seinen Erinnerungen Die Welt von Gestern, als es galt, nach seiner Exilierung sich um eine Aufenthaltsgenehmigung in England zu bemühen, schrieb er: „ […] am Tage, da ich meinen Paß verlor, entdeckte ich mit achtundfünfzig Jahren, daß man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde.“ Und er zitierte Franz Grillparzers Wort: „zwei Fremden und keine Heimat“ haben, unbehaust in „geborgten Sprachen“ sein und umgetrieben vom Wind. Wir haben in unserer Zeit, heute, wieder mehr als Anlässe genug, selbst erfahren zu müssen, was das bedeutet.
Wird einem die Fremde, das Exil, je zur Heimat? Ist das eine Frage der Integrationsbereitschaft der Anderen und/oder der Integrationswilligkeit des Migranten, wobei Willigkeit und Bereitschaft im Fall der Integration wechselseitige Erfordernisse sind. Neben der ‚Heimat’ als einem traditionellen Modewort gehören inzwischen Identität und Integration zur nämlichen Kategorie. Wir integrieren den Anderen, weil wir seinen nicht-integrierten, treffender gesagt: angepassten Zustand nicht ertragen können. Das Andere soll eingeebnet werden: Heimat als Planiergebiet, als Integrationszwangsort. Wir halten ja oft nicht einmal den exzentrischen Nachbarn aus, selbst oder gerade wenn er auch unser Blutsverwandter wäre. Abweisend reagieren wir auf den Außenseiter. Franz Kafka, der sich zeitlebens von Prag nicht wirklich emanzipieren konnte, schuf zwei Kunstfiguren, einen zum Menschen mutierenden Affen und einen aus seiner Art geschlagenen Hund, um sich über seine Artgenossen im Klaren werden zu können. Und dann war da noch K. , der an seiner Heimat verzweifelt, ein Außenseiter wenn es je einen gab, dem Dinge widerfahren, auf die er sich keinen Reim machen kann. Nur die Anderen, die gemütlich Beheimateten, halten es für selbstverständlich, was K. auf dem Weg zum Schloss an Unverständlichem begegnet. K. wird zum wurzellosen Fremden in seinem angestammten oder besser: vom Leben zugewiesenen Bereich. Hinzu kam noch diese Einsicht: Schakalen sei die Wüste Heimat, wie Kafkas unter die Araber geratener Erzähler berichtet, und zwar der reineren Luft wegen.
III
Heimat, das ist ein Märchen- und Schattenwald, wobei es die Schatten sind, die Märchen erzählen. Kafkas Verweis auf die verschiedenen Arten der Kreatürlichkeit im Verhältnis zur Heimat hat übrigens ein romantisches Vorbild, ausgedrückt im
„Sonett an Cäzilia“ in: E.T.A. Hoffmanns Erzählung Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza:
Der Frühling kommt auf blauen Wolkenwogen,
In duft’ger Ferne leuchtet sein Gefieder,
Den stillen Wald beleben frohe Lieder,
Der Heimat sind die Sänger zugeflogen.
Zuletzt doch etwas Heiterkeit? Oder sieht sich hier die frühe Heimat-Rhetorik der Romantik durch einen ihrer prominentesten Vertreter ironisiert, wenn nicht gar vorgeführt und damit bloßgestellt?
Heimat – wie hart soll man mit ihr ins Gericht gehen? Ist ihr gegenüber nicht doch mehr Urteilsmilde angebracht? Ob der kritische Umgang mit ihr immer wieder eine Art Selbstverletzung bedeutet oder verstärkt sich dadurch das eigene Selbstwertgefühl in Abgrenzung zu den eigenen Ursprüngen, den allzu-heimatlichen, nämlich indem man sich an ihnen reibt, gar aufreibt?
„Wo gehen wir denn hin?“ fragte Novalis. Eine Antwort, die sinnigerweise erst posthum zur Veröffentlichung kam, lautet schlicht: „Immer nach Hause.“ Wie aber wenn dieses Zuhause seinerseits ins ‚Gehen’ gerät, sich kaum noch lokalisieren lässt, uns nachgeht – durchaus auch als Alp? Wenn die Heimat zum Gegenstand der Tümelei wird oder im Kitsch ihrer hemmungslosen Folklorisierung erstickt? Und was, wenn es unheimlich wird in der Heimat, wenn die um sich greifende Vereinsamung selbst die Geborgenheit in der Heimat als Trug entlarvt? Dann mögen diese scheinidentischen Strophen uns zu denken geben:
Die Krähen schrei’n
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnei’n –
Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!
[…]
Die Krähen schrei’n
Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:
Bald wird es schnei’n –
Weh dem, der keine Heimat hat!
Also schrieb Friedrich Nietzsche, der sich selbst als philosophierender Vagant verstand, von Naumburg auszog über Leipzig, Bonn, Basel, Sils Maria, Nizza und Turin, um dem selbstgefälligen Schlafmützenbürgertum denkend das Fürchten zu lehren. Korsika hatte er im Blick, Nordafrika hätte er liebend gerne gesehen, überseeische Zonen gar, nur um Griechenland machte er einen großen Bogen, er, der vermutlich beste Kenner seiner Zeit der klassisch-griechischen Literatur und Philosophie. Er hatte ja eine Heimat gehabt, aber nur, weil er sie verwirken wollte, schwankte selbst zwischen ‚Wohl dem’ und ‚Weh dem’. Damit hatte er Hölderlin beerbt, dem zuletzt die Heimat zum angenehmen Ort des Grauens wurde, zum locus amoenus horribilisque, der zuletzt nur in der Entrücktheit, im vermeintlichen Wahnsinn die Heimat ertrug. Sie holte ihn ein, holte ihn zurück; denn wer in die Heimat zurückkehren will oder muss, bleibt bis zuletzt ein Heimgesuchter.
IV
Wo aber geht die Heimat hin?, so könnten wir – Novalis abwandelnd – fragen. Vielleicht geht sie dorthin, wohin wir sie mitnehmen als zögerliche Begleiterin – mitten in unsere Illusionen oder mediengeschürten Ängste.
Heimat ist Vieles, aber eines gewiss auch: ein unromantisches Politikum, eine Geschichte von Vertreibungen – in der Neuzeit seit dem Exodus der Hussiten aus Böhmen und der Hugenotten aus Frankreich Haben wir überhaupt bereits bemerkt, wie gespalten unsere Heimaten inzwischen wieder geworden sind? Ist Heimat ein politischer Spaltpilz? Knapp drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der brutalsten Heimatspaltung überhaupt nach den Weltkriegen und ungezählten regionalen Zerreißungen und Vertreibungen - man denke allein an den Balkan, an die Ukraine oder die Kurdenfrage sowie den mittleren Osten –, stehen wir vor gesellschaftlichen, ökonomischen und mentalen Spaltungen, für die der Brexit ebenso kausal verantwortlich ist wie die Lage in Spanien, Italien, die deutsche Rechtsszene und die Unerträglichkeit des Trump-Regimes, das im Namen der Homeland Security Restriktionen erlassen hat, die eines freiheitlichen Landes ebenso unwürdig sind, wie das, was sich seit dem EU-Referendum in Britannien abspielt. Das familiäre und nachbarschaftliche ‚Zuhause’, also die Kernsubstanz des Miteinander in den diversen Heimaten, ist für viele durch diese Extremsituationen gespalten. Ideologische Gräben von einer seit dem kalten Krieg nicht mehr erlebten Tiefe haben sich in den Heimaten dieser Länder aufgetan. Die Heimat sieht sich in Sicherheitszonen aufgeteilt. Im Krieg gegen den Terror ist die Heimat wieder zur Front geworden, wo uns lieb gewordene Freiheiten absterben, oft ohne dass wir es bemerken, wo wir uns zweimal überlegen, was wir wem sagen, wo das schleichende Gift der Selbstzensur die freie Meinungsäußerung und damit den belebenden Diskurs zu lähmen droht.
Und gleichzeitig gerät sie neu in den Blick, die ‚Heimat Europa’, das Vorhandensein eines in der Geschichte einmaligen politischen, kulturellen und ökonomischen Strukturbereichs, der zum Beispiel verhindert, dass regionale Konflikte unweigerlich im Chaos enden.
Das demokratische Selbstverständnis in der westlichen Welt hat in einem kollektiven, mediengestützten Akt selbstverschuldeter Unmündigkeit jüngst zwei absolute Tiefpunkte erlebt: der letzte amerikanische Präsidentschaftswahlkampf und die Vorgänge um das EU-Referendum in Britannien. Noch einmal sei gesagt: das Ausmaß an ‚fake news’, also mutwilligen Erfindungen über das, was Realität und Sache ist, und ihre Verbreitung durch die sogenannten sozialen Medien, betrifft im digitalen Zeitalter jeden heimatlichen Sprengel. Im globalen Dorf – und das gilt es sich immer wieder zu vergegenwärtigen – herrschen Gerüchte und Vorurteile ungleich rascher und wirkungsmächtiger als im bloßen Schatten des Kirchturms, wobei sich die Beziehungsgeflechte überlagern: das dörflich-heimatliche Gemeinschaftsleben sowie die sozialen Netzwerke, sie verschränken sich, ja, sie lösen sich zuweilen ineinander auf.
V
In der Schweiz, so hört man, sollen staatliche Prämien denjenigen zugute kommen, die aus den Städten in die Landgemeinden ziehen, dem ‚Dörfli’ wieder Substanz zurückgeben und damit die kantonalen Urheimaten neu beleben wollen. Vielleicht geschieht dies demnächst auch in Mecklenburg-Vorpommern und anderen verwaisten Landstrichen Europas, die einst Heimatgrund gewesen sind und nun veröden. Doch kann das gelingen, das Wiederbeseelen von Verödetem? Was sich da abzeichnet sind Agenden oder Aufgabenbereiche für regelrechte Heimatministerien, wie es dies in Nordrhein-Westfalen und Bayern eines gibt, angesiedelt übrigens in Nürnberg, nicht in der Metropole München, ein Ministerium für Dezentralisierung wenn man so will, in dem es auch um Planspiele geht, wie sich die Urbanisierung wieder rückübersetzen ließe in eine Ruralisierung. ‚Romantisches’, beklemmender Weise aber auch völkisches Erbe verbindet man nämlich hauptsächlich mit dem Ländlichen als einer vermeintlich ‚wirklichen’ Heimat. Das impliziert, dass der städtische Geborene gleichsam am Rande zur Heimatlosigkeit zur Welt gekommen sei. Es ist mühsamer als man zunächst denkt, von diesen Vorstellungsmustern sich zu lösen.
Nun ist ein Stichwort genannt, die – zuvor räumlich gemeinte – Übersetzung, ein Begriff, der mit ‚Heimat’ ursächlich verwandt ist. Walter Benjamin hatte einst darauf hingewiesen, dass einen Unterschied macht, ob einer Brot oder pain sagt, paysage oder Landschaft. Benjamin schreibt: „Das Gemeinte ist zwar dasselbe, die Art es zu meinen, dagegen nicht.“ In unseren Tagen sekundiert Navid Kermani diese Überlegung, wenn er über den Unterschied von Heimat und dem persischen Wort dafür watan nachdenkt. Oder wenn die deutsch-japanische Autorin Yoko Tawada den Unterschied von Wasser und Misu (japanisch für dieses Lebenselement) reflektiert und daraus einen ganzen Roman werden ließ (Wo Europa beginnt) und befindet, das Wirt ‚Wasser’ klinge nach Fließen, nach Energie durch seine doppelkonsonantische Mitte; ‚Misu’ dagegen meditativ-beruhigt, dem Rauschen beraubt. Ganz ähnlich der persische, auf Deutsch schreibende Dichter SAID, der befindet: „noch immer hat das deutsche wort ‚durst’ für mich keinen vorgeschmack, keine konsequenz; dazu regnet es zu oft in meinem deutschland.“ Übrigens kennt das Persische drei Worte für ‚Heimat’, nämlich watan, mihan und zad-gah, wobei das zweite, mihan oder mihane, ein weiblicher Vorname sein kann, damit das in sprechendster Namenssymbolik das Beheimatende im Mütterlichen benennend. Dem des Persischen rudimentär kundigen, mit den Dichtungen des mit diesen Bedeutungsebenen des Weiblich-Heimatlichen spielenden Hafis vertrauten Goethe lag folgerichtig nichts näher als seinem Faust den „Gang zu den Mütter“ aufzuerlegen. Denn dort – bei den Müttern – findet sich der Quellbereich des Denkens, Fühlens und Wollens; denn wir werden immer auch, was wir denken und fühlen, werden mithin auch immer wieder auf unserem eigenen Ursprung zurückverwiesen, zur Heimat in uns oder, liebend, im Anderen. Die vorige Behauptung, ‚Heimat’ sei eine Verwundung, kaschiert als Muttermal gewinnt vor diesem Hintergrund eine ganz eigene Bedeutung; denn dieses Werden zur Heimat in uns geht meist nicht ohne (Selbst-)Verwundung ab, die wir in Gestalt eines Muttermals erträglicher vernarbt sehen.
Vielleicht sind wir damit ja auch beim Eigentlichen angekommen, was das notwendig zweideutige Verhältnis zum Heimatlichen angeht – beim Problem der vielfachen verbal-psychologischen Übersetzbarkeit von ‚Heimat’ – von der eigenen Psyche ins Kollektive, von der Region ins Europäische, vom Europäischen ins Ethos einer Weltgemeinschaft. Wir sprachen zuvor vom Transitären in uns, von dem also, was über unsere eigene Identität hinausweist, weil wir ihrer ja ebenso wenig sicher sein können wie unseres Verhältnisses zur Heimat gegenüber. Heimat ist Ursprungsort und Absprungbereich ins Andere, ist Illusion von Unversehrtheit, aber auch der Ort phasenweiser Geborgenheit und sei es nur der Topos für unsere Vorstellung von Geborgenheit. Wenn wir ‚Heimat’ zu übersetzen versuchen, etwa dorthin wo wir uns neu ansiedeln und uns nicht selten mit Relikten des Abgestammten, des Ursprungsorts umgeben, dann schöpfen wir damit im Grunde immer auch ein Potential des Heimatlichen mit aus, seine Symbolik und Mehrwertigkeit. Wer den Heimatbegriff politisch monopolisieren will, vergeht sich an eben diesem Potential. Das Wertvollste, was wir unseren Heimaten zurückgeben können ist und bleibt, dass wir sie verteidigen gegen ihre Ideologen, das wir das unleugbar Gemütvolle an ihr schützen gegen die Willkür ihrer Instrumentalisierer. Denn der Umgang mit dem Eigenen, Angestammten, scheinbar Vertrauten wie mit dem Fremden will in der Tat sorgfältig gelernt sein. Hölderlins so bedeutsame Grundeinsicht zu verlernen, würde bedeuten, reaktionären Heimattümlern das Feld zu räumen. Und was das wiederum bedeuten müsste, steht als Menetekel nicht nur an deutschen Wänden allzu deutlich lesbar geschrieben.