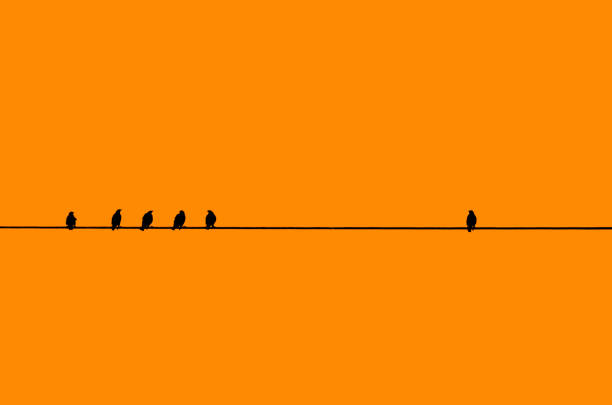Ist Liebe ein soziales Gefühl? Die philosophischen Theorien und literarischen Darstellungen der Liebe haben auf diese Frage im Laufe der Jahrhunderte sehr unterschiedliche Antworten gegeben (vgl. Geisenhanslüke 2016). Und diese Antworten können auf unterschiedliche Arten anstößig sein – weil sie das Soziale auf Vorstellungen der Liebe begründen, die uns heute fremd, ja verdächtig vorkommen mögen, oder weil sie Liebe gar nicht als ein soziales Gefühl, sondern als einen radikal antisozialen Affekt darstellen. Für beide Ideen – Liebe als soziales oder als antisoziales Gefühl – gibt es prominente Fürsprecher und ihre Nachfolger. Im ersten Fall ist es Platon, im zweiten Shakespeare.
In der griechischen Mythologie besetzt Eros, der Gott der geschlechtlichen Liebe, eine ebenso zentrale wie umstrittene Stelle. Das macht schon die erste Erwähnung des Gottes bei Hesiod deutlich: „der Eros, der schönste unter den unsterblichen Göttern“ (Theogonie, Vers 120) nennt ihn Hesiod, aber er versieht dessen Macht mit einigen bedenklichen Zusätzen. Denn seine Herrschaft ist nicht vereinbar mit den Gesetzen der Vernunft, der phronesis, um die sich vor allem die Philosophie bemüht: Er ist stärker als der kluge Ratschluss, so Hesiod, sein Wirken ist nicht immer mit den Vorgaben des Denkens und der Moral konform: Er treibt Ares und Aphrodite zum Ehebruch, stiftet heilige wie unheilige Verbindungen zwischen Göttern, Göttern und Menschen, sogar zwischen Menschen und Tieren. Die geschlechtliche Liebe erscheint in der griechischen Mythologie als eine ebenso kostbare wie gefährliche Ursprungsmacht, die alles Leben ermöglicht, zugleich aber unübersehbare Verwicklungen schafft, gegen die die Vernunft machtlos bleibt.
Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass die philosophische Auseinandersetzung mit dem Eros dieser Ambivalenz von Beginn an Rechnung getragen hat. Besonders deutlich wird das im Symposion, einem Dialog Platons, der sich ganz um den Eros dreht. Die Ambivalenz des Eros wird schon durch die Tatsache verdeutlicht, dass Platon nicht weniger als sechs Redner aufruft, die dem Gott der Liebe ein Loblied singen sollen. Das Platonische Gastmahl gibt sich so als ein Wettstreit zu erkennen, bei dem Vertreter Athens in verschiedenen Funktionen – als Bürger, Arzt, Dichter oder Philosoph – auftreten. In einem Punkt aber sind sich alle Redner einig: dass die höchste Form der geschlechtlichen Liebe in der Verbindung eines älteren Mannes mit einem Knaben besteht. Das Symposion ist so neben seiner philosophischen Bedeutung auch eine ideologische Rechtfertigung der außerhalb Athens verpönten Knabenliebe, der Päderastie. Alle sechs Redner erkennen in der Verbindung zwischen dem älteren Liebhaber und dem jungen Geliebten nicht nur ein erotisches, sondern zugleich ein pädagogisches Modell: Die begabtesten Jünglinge Athens sollen ihre Erziehung durch die Anleitung älterer Männer erfahren. Aus diesem Männer- und Knabenbund sind Frauen ausdrücklich ausgeschlossen. Die Macht des Eros gibt so das politische Modell für einen Staat, dessen Grundfeste im Wesentlichen auf der Knabenliebe beruht – eine Vorstellung, die heute mehr als nur Anstoß zu erregen vermag.
Nicht minder drastisch, aber unter umgekehrten Vorzeichen, geht Shakespeare in Romeo und Julia vor. In seiner Tragödie setzt er ein Begehren in Szene, das keine gleichgeschlechtlichen Partner unterschiedlichen Alters verbindet, wie es bei Platon der Fall war, sondern zwei sehr junge Menschen verschiedenen Geschlechts, die in einer Form der Liebe zueinander finden, die alles andere ausschließt und sich jenseits jeder politischen oder poetischen Konvention bewegt.
Das wird besonders deutlich an dem Verhältnis Julias zu ihrer Familie. Die nicht einmal vierzehnjährige Julia lässt sich ohne das Wissen der Familie mit dem geliebten Romeo vermählen. Ihr Bruch mit allen sozialen Konventionen ist so radikal, dass selbst der Mord Romeos an ihrem Cousin Tybalt nichts an ihren Gefühlen ändert. Im Gegenteil: Als sie von dessen Tod erfährt, ist sie nur glücklich, dass es nicht Romeo ist, der gefallen ist.
Shakespeare inszeniert Liebe epochemachend als ein starkes Gefühl, das zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts unter Ausschluss aller anderen sozialen Banden aneinander fesselt. Was der Soziologe Niklas Luhmann im Blick auf das 18. Jahrhundert „Liebe um der Liebe willen“ genannt hat, entpuppt sich schon bei Shakespeare als ein antisoziales Gefühl, das seinen ultimativen Ausdruck in dem gemeinsamen Tod der beiden Liebenden findet. Und es ist diese in gewisser Weise romantische Idee eines alles ausschließenden Gefühls, die heute noch die populären Vorstellungen des Liebesbegriffs bestimmt. Bei aller Idealisierung eines Gefühls, das dazu in der Lage ist, die Einstellung des Menschen zu sich und der Welt von Grund auf zu verändern, sollte der Leser durch das Beispiel von Romeo und Julia aber zugleich gewarnt sein: Liebe verbindet Menschen zwar, trennt sie aber auch von all denjenigen, die ihren Furor nicht teilen.
Geisenhanslüke, Achim: Die Sprache der Liebe. Figurationen der Übertragung von Platon zu Lacan, Paderborn 2016.
Hesiod: Theogonie. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Karl Albert, Sankt Augustin 1985.
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt am Main 1982.
Platon: Symposion. Werke in acht Bänden. Herausgegeben von Günter Eigler. Dritter Band, Darmstadt 1974.
Shakespeare, William: Romeo and Juliet. The Arden Edition. Third Series. Edited by René Weis, London 2012.