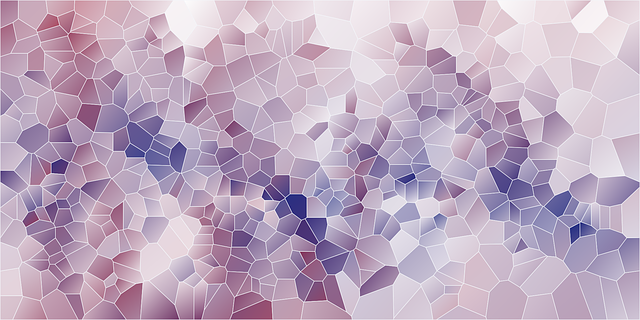I
Die experimentelle Philosophie ist ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der empirischen und experimentellen Methoden bei der Beantwortung philosophischer Fragen eine grosse Bedeutung beimisst. Experimentelle Philosoph:innen verwenden Methoden aus der Psychologie, experimentellen Linguistik, den Neurowissenschaften, und vielen anderen Bereichen der Kognitionswissenschaften, und sie wenden diese auf Fragen der Philosophie an, die eine empirische Antwort verlangen. Ich habe bereits an anderer Stelle in diesem Blog versucht, die experimentelle Moralphilosophie ein wenig näher zu beleuchten. Wärmstens zu empfehlen ist auch der Artikel von Max Bauer, der sich mit der experimentellen Philosophie allgemein beschäftigt. In diesem Beitrag möchte ich einen Bereich der Moralphilosophie vorstellen, von dem ich denke, dass er in besonderem Masse von der experimentellen Zugangsweise profitieren kann, nämlich die Metaethik.
Was ist Metaethik genau? Die Metaethik ist ein Teilbereich der Moralphilosophie und ist geleitet von dem Versuch, die metaphysischen, epistemologischen, semantischen und psychologischen Voraussetzungen von moralischem Denken, Sprechen und unserer moralischen Praxis zu verstehen. Vereinfacht ausgedrückt: Metaethiker:innen interessieren sich nicht dafür, welche Handlung genau moralisch gut oder schlecht ist – dieses Projekt überlassen sie den normativen Ethiker:innen. Metaethiker:innen wollen vielmehr wissen „Wenn ich sage, dass es moralisch falsch ist, Kinder zu schlagen, was genau bedeutet dann hier das Wort ‚falsch‘ eigentlich?“. Man könnte beispielsweise denken, dass „falsch“ eine absolute Wahrheit ausdrückt und moralische Urteile damit wissenschaftlichen Erkenntnissen ähnlich sind. Alternativ kann man denken, dass moralische Wörter sich eher verhalten wie Geschmacksurteile oder Aussagen über persönliche Gefühle. Metaethiker:innen interessieren sich dafür, welche Position Moralurteilen gerecht wird. Ebenso interessieren sich Metaethiker:innen dafür, wie wir eigentlich genau zu moralischen Urteilen kommen. Sind sie beispielsweise das Produkt unserer Vernunft oder unserer Gefühle? Diese sind nur eine wenige Frage, mit denen Metaethiker:innen sich beschäftigen.
Es ist vermutlich leicht zu sehen, dass diese Fragen nicht durch blosses Nachdenken beantwortet werden können. Wenn wir wissen wollen, was ein Wort bedeutet, dann denken wir typischer Weise nicht einfach nach und hoffen, dass uns die Antwort von allein kommt. Typischer Weise fragen wir andere, von denen wir denken, dass sie die Bedeutung des Wortes kennen. Und da wir damit oft ziemlich erfolgreich sind, scheint es doch nahe zu liegen, dass auch Metaethiker:innen einfach jemanden fragen sollten, was moralische Wörter denn nun bedeuten. Genau das ist es, was experimentelle Philosoph:innen wie ich versuchen.
Lasst uns an einem kleinen, ganz konkreten Forschungsprojekt anschauen, wie so eine Befragung genau aussehen könnte und welche Antworten sie uns geben kann.
II
Begriffe wie „unhöflich”, „grausam”, „freundlich“ oder auch „mitfühlend“ gehören zu der Gruppe der sogenannten dicken ethischen Begriffe und werden dünnen ethischen Begriffen wie „gut“, „schlecht“ gegenübergestellt. Gemeinsam bilden sie die Gruppe der evaluativen, also bewertenden Begriffe. Dünne ethische Begriffe sind rein evaluativ. Wenn wir sagen „Toms Verhalten war gut“, dann geben wir ein bewertendes Urteil über Toms Verhalten ab. Aber so wirklich informativ ist dieses Urteil nicht. Warum war es gut? Gut in welchem Sinne? Was genau ist es, das Toms Verhalten gut macht? Dünne ethische Begriffe sind diesbezüglich nicht besonders aufschlussreich. Sie sind… nunja… etwas dünn. Dicke ethische Begriffe sind hingegen deutlich informativer. Wenn wir sagen „Tinas Verhalten war unhöflich“, dann kommunizieren wir ebenfalls ein negatives Urteil. Aber in diesem Fall können wir uns deutlich leichter vorstellen, wie Tina sich wohl verhalten hat und für was genau wir sie negativ bewerten – sie hat vermutlich Konventionen des freundlichen Umgangs miteinander nicht eingehalten. Vielleicht hat sie einen Bekannten nicht gegrüsst, unangemessene Sprache verwendet oder sich an der Kinokasse vorgedrängelt. Dicke ethische Begriffe sin reich(er) an deskriptiven Informationen, zusätzlich zu der Evaluation, die sie kommunizieren.
Ein wichtiges Projekt in der Metaethik beschäftigt sich mit der Frage, wie genau dicke ethische Begriffe diese Evaluation nun aber kommunizieren und ob die Evaluation zur eigentlichen Wortbedeutung dicker Begriffe gehört. Was ist damit gemeint? Um das zu verstehen, sollten wir uns zunächst mit zwei Beispielen von nicht-ethischen Begriffen weiterhelfen.
Das Wort „Junggeselle“ kommuniziert eine Reihe von rein deskriptiven Informationen, die gemeinsam die semantische Bedeutung von „Junggeselle“ ergeben. (Nebenbemerkung: Als „semantische Bedeutung“ verstehen Philosophen ungefähr das, was wir im Wörterbucheintrag zum jeweiligen Wort finden würden.) Junggesellen sind (1) unverheiratet und (2) männlich. Jeder kompetente Sprecher der deutschen Sprache wird beide diese Eigenschaften aus dem Wort „Junggeselle“ ableiten. Wie genau kommuniziert das Wort „Junggeselle“ nun aber „unverheiratet sein“? Stellen wir uns vor, wir versuchten herauszufinden, ob wir, wenn wir sagen „Stefan ist ein Junggeselle“, gleichzeitig verneinen können, dass Stefan unverheiratet ist: „Stefan ist ein Junggeselle, aber damit will ich nicht sagen, dass er unverheiratet ist“. Eine solche Aussage erscheint ziemlich seltsam und selbstwidersprüchlich. Die Sprecherin scheint nicht wirklich zu verstehen, was das Wort „Junggeselle“ bedeutet. Behalten wir das für einen kurzen Moment im Kopf.
Nehmen wir ein zweites Beispiel: Der Satz „Ich bin hungrig“ kommuniziert ebenfalls deskriptive Informationen. Der Sprecher sagt etwas darüber aus, dass er… naja… hungrig ist. Aber was verstehen wir über diesen Satz hinaus noch? Abhängig vom Kontext werden wir weitere Informationen aus dieser Aussage ableiten, beispielsweise dass der Sprecher uns auffordert, uns in die Mittagspause zu begleiten oder unser Sandwich mit ihm zu teilen. Anders als im Fall von „Junggeselle“ und „unverheiratet“ kann diese Information jedoch widerspruchsfrei verneint werden: „Ich bin hungrig, aber ich will damit nicht sagen, dass du mich in die Mittagspause begleiten sollst“ – Dieser Satz klingt vollkommen ok.
Im Fall des Junggesellen sagen Philosoph:innen, dass „unverheiratet“ semantisch impliziert ist. Es gehört zur semantischen Bedeutung von „Junggeselle“, dass sie unverheiratet sind. Die Aufforderung, die wir aus „ich bin hungrig“ ableiten, ist hingegen eine konversationale Implikatur und gehört nicht zur semantischen Bedeutung. Sie ist eine Information, die wir über das wörtlich Gesagte hinaus ableiten können, weil wir typischer Weise wissen, mit welchen sozialen Absichten Sprecher:innen bestimmte Aussagen treffen.
Warum erzähle ich das alles? Metaethiker:innen stellen die Frage, ob die Evaluation eines dicken ethischen Begriffs eher semantisch impliziert ist und daher fest und unauflöslich mit dem Begriff verbunden ist oder ob die Evaluation eine konversationale Implikatur ist und kontextabhängig von uns abgeleitet wird, weil wir Annahmen über die Absichten des Sprechenden treffen. Aus diesen Überlegungen können wir eine ganz konkrete, empirisch und experimentell überprüfbare Fragestellung ableiten: Wenn Sprecher:innen sagen „Was Jenny gestern gemacht hat, war grausam, aber damit will ich nichts negatives über ihr Verhalten aussagen“, widersprechen sie sich dann? Diese Frage schreit förmlich danach, von experimentellen Philosoph:innen untersucht zu werden!
III
Gemeinsam mit Kevin Reuter bin ich dieser Frage nachgegangen. Wir haben uns eine ganze Reihe von dicken ethischen Begriffen vorgenommen und Sätze der folgenden Art konstruiert:
-
„Was Jenny gestern gemacht hat, war grausam, aber damit will ich nichts Negatives über ihr Verhalten aussagen.“
-
„Was Tom gestern gemacht hat, war freundlich, aber damit will ich nichts Positives über sein Verhalten aussagen.“
Diese Sätze haben wir dann über 800 Leuten auf einer Internetplattform präsentiert und sie gefragt, ob die Sprecherin sich selbst widerspricht. Wenn die Evaluation eines dicken ethischen Begriffs zu dessen Semantik gehört, dann sollten wir finden, dass sich diese Sätze genauso widersprüchlich anhören wie „Stefan ist ein Junggeselle, aber damit will ich nicht sagen, dass er unverheiratet ist“. Wenn die Evaluation allerdings eine konversationale Implikatur ist, dann sollten unsere Testsätze genauso akzeptabel sein wie „Ich bin hungrig, aber ich will damit nicht sagen, dass du mich in die Mittagspause begleiten sollst“.
Was finden wir? Bevor ich das verrate, lade ich euch ein, eure eigenen Intuitionen zu befragen? Sind die beiden Sätze oben ok oder widersprüchlich? 3… 2… 1… Ok!
Unsere Experimente ergeben zwei spannende Resultate. Zum einen scheint es so, dass die Evaluation sich weder so verhält wie eine semantische Implikation noch wie eine konversationale Implikatur. Die Evaluation ist enger an den dicken Begriff gekoppelt als eine konversationale Implikatur, aber gleichzeitig leichter zu verneinen als eine semantische Implikation. Was sollen Philosoph:innen daraus jetzt machen?! Eine gute Frage, die sicherlich noch mehr sorgfältige Arbeit erfordert – sowohl auf rein theoretischer wie auch experimenteller Seite. In jedem Fall fordert uns dieses Ergebnis bereits heraus, bisher etablierte philosophische Theorien zu überdenken.
Das zweite Resultat sollte Philosoph:innen noch mehr Kopfschmerzen bereiten. Philosoph:innen haben bislang angenommen, dass alle dicken ethischen Begriffe gleich funktionieren. Getreu dem Motto: Kennst du einen, kennst du alle! Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Annahme nicht gerechtfertigt ist. Stattdessen finden wir, dass eine negative Evaluation wie in „Was Jenny gestern gemacht hat, war grausam, aber damit will ich nichts Negatives über ihr Verhalten aussagen“ nicht so leicht verneint werden kann wie eine positive Evaluation in „Was Jenny gestern gemacht hat, war freundlich, aber damit will ich nichts Positives über ihr Verhalten aussagen“. Der erste Satz erscheint unseren Testpersonen widersprüchlich, der zweite deutlich weniger. Einen solchen systematischen Unterschied zwischen negativen und positiven Wörtern haben Philosoph:innen nicht erwartet.
Zu diesem Zeitpunkt können wir nur spekulieren, wie diese unterschiedlichen Intuitionen zustande kommen. Wir arbeiten momentan daran, diesen Effekt zwischen positiven und negativen Effekten zu erklären. Ich würde mich über Vorschläge sehr freuen und lade alle Leser:innen dieses Blogs ein, uns ihre Intuition zukommen zu lassen. Schreibt uns und kommentiert gerne diesen Beitrag! Wir sind überzeugt, dass unsere philosophische Reise durch die Welt der dicken und dünnen Begriffe gerade erst begonnen hat und diese ersten und noch unerklärten Ergebnisse weitere Studien fordern.
Literatur