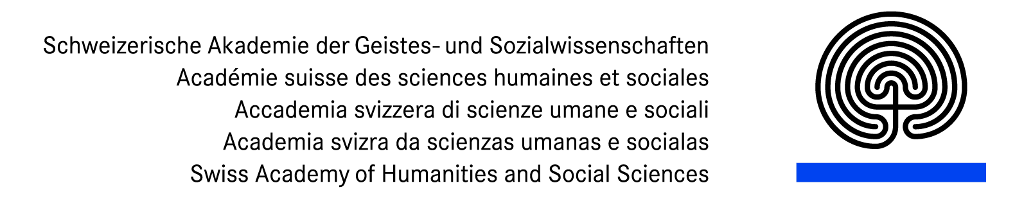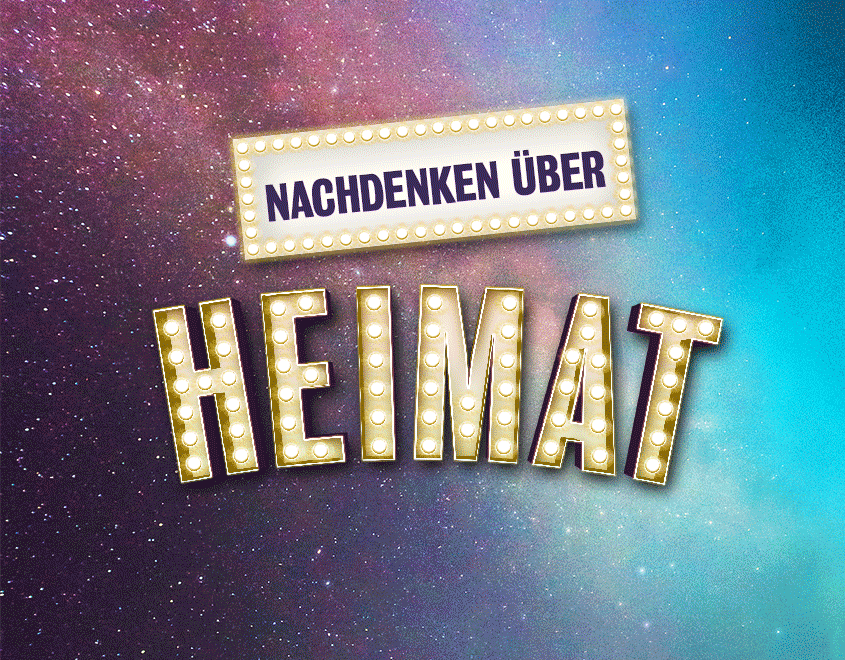Das inflationäre Gerede über Heimat hält jetzt schon so lange an, dass man hoffen darf: Es dauert nicht mehr lange, dann ist auch diese intellektuelle Mode vorüber und wird durch die nächste abgelöst. Bevor das Thema erst vor kurzem nach den Feuilletons der Tageszeitungen und den Lifestyle-Magazinen auch die metropolitanen Subkulturen und die Regierungspolitik eroberte, schien es so, als wären die Zeiten vorbei, in denen es nennenswerte Resonanz hätte geben können für die Angebote und Zumutungen, die vom Heimatbegriff ausgehen. Die modernen Lebensverhältnisse stehen doch ganz im Zeichen von Mobilität, Flexibilität, bewusst angeeigneter Pluralität und Weltbürgertum – eine Tendenz, die gegen die artifizielle Horizontverengung der Heimatverbundenheit spricht, gegen die gleichsam natürliche atmosphärische Restriktion auf dörfliche, allenfalls kleinstädtische Verhältnisse, gegen die Assoziationen, die dem Begriff anhaften: von umgebendem Gefilde, ländlicher Sittlichkeit, emotionaler Bindung an eine Region, von gediegener Gemeinschaft und Verwurzelung im Vertrauten. Welchem Großstädter wäre jemals, selbst wenn seine Familie zu den conditoribus urbis gehörte, über die Lippen gekommen, die Stadt (Berlin, Zürich, Rom, Paris, Madrid?) sei seine Heimat? In der Reserve und Idiosynkrasie gegen „Heimat“ schwingt dabei allemal mit, dass der Terminus schwer belastet ist durch die völkischen und nationalistischen Perversionen der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Viele selbst unter denen, die ihre Zugehörigkeit zu Landstrich und Region ihrer Herkunft betonen, fremdeln mit dem Ausdruck „Heimat“ und beargwöhnen ihn nicht allein als überholte Form womöglich bloß vorgegebener Nähe und Unmittelbarkeit, sondern als Reservat des Reaktionären und Faschistoiden.
Woher da mit einem Mal die Heimatverbundenheit? Ohne dass damit eine monokausale Erklärung von der Art nahegelegt sein soll, wie sie niemals taugen, muss man doch das allzu Offensichtliche wahrnehmen: Seit der `Flüchtlingswelle´ und dem gesteigerten Problembewusstsein von den Kollateralschäden eines allzu unbedenklichen Umgangs mit dem Migrationsproblem versuchen europaweit rechtsradikale Politiker Stimmung zu machen mit dem noch diffusen Unbehagen und der Angst mancher Gruppen der Bevölkerung vor sozialer Übervorteilung – und vor `Überfremdung´ ihrer Heimat; und geschlickerte konservative Politiker versuchen zur Arrondierung ihrer Klientel voller Eifer auf den Zug des rhetorisch-affektiven Trends aufzuspringen. Als seismographisches Detail darf hier etwa gelten, dass in Deutschland der jüngste Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD es vorsieht, dem Innenministerium der BRD in der nächsten Legislaturperiode ein Heimatressort hinzuzufügen, das es bis dahin noch nicht gab. Weniges könnte bezeichnender sein für die Tendenzen zur Stimmungsdemokratie, unter denen Europa gegenwärtig so sehr leidet.
Kurz und knapp: Es gibt sympathischere intellektuelle Moden als die des gegenwärtigen Heimatbewusstseins. In der Heimat-Mode verdichten sich die Fehler und Gefahren der europäischen Politik zur retrospektiven Kenntlichkeit. Ein Grund mehr, die Reserve zu kultivieren gegenüber einem Terminus, der den meisten Zeitgenossen fern gelegen hatte, bevor er im Duktus einer rhetorischen Übersprungreaktion als naheliegend adaptiert wurde?
Gewiss. Aber auch ein Grund zur Erinnerung an das, was man von nachdenklichen Menschen wohl erwarten darf.
Denn missbrauchen lässt sich alles. Und die ideologische Intervention würde nicht funktionieren, träfe sie nicht auch die Bedürfnisse so vieler keineswegs völkisch-nationalistischer Zeitgenossen, die den Terminus „Heimat“ offenkundig erst wie eine neue Vokabel lernen mussten (so ähnlich wie „Nachhaltigkeit“, „Entschleunigung“, „Achtsamkeit“ oder eine Formel wie „was das mit mir macht“), Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, die sich offenbar auf das Wort „Heimat“ reimen. Es kann nicht darum gehen, den Heimatbegriff pauschal zu inkriminieren oder zu annullieren. Geboten ist allein der reflektierte Umgang mit dem Anspruch, den er artikuliert – ein Problembewusstsein, in dem zum einen endlich auch der in der Migrationskrise dokumentierte Befund seinen Ort hätte: dass es für die Flüchtlinge Zustände und Erfahrungen gab, angesichts derer Heimat aufhörte ein absoluter Wert zu sein; in dem es zum anderen die vermeintliche Paradoxie zu verstehen gilt, dass die Verhältnisse in einer Welt der beschleunigten Mobilität und kulturellen Diversität den Wunsch nach Heimat keineswegs gegenstandslos werden lassen.
Was mir bei diesem Projekt der Differenzierung vordringlich geboten scheint: den bisher zu wenig beachteten Unterschied ernst und zum Leitfaden zu nehmen, den man mit Ernst Cassirers Ansatz zwischen einem Substanzbegriff von Heimat und ihrem Funktionsbegriff machen müsste. Nicht an der Scholle klebt ein für allemal die Heimat – sie lebt vielmehr in der Intensität allemal menschlicher Verhältnisse, insbesondere wohl an der Möglichkeit der Partizipation an ihrer Gestaltung. Was Dolf Sternberger mit dem Terminus „Verfassungspatriotismus“ statuiert hat, kann in diesem Sinne ein methodisches Exempel auch für einen aufgeklärten Umgang mit dem Heimatbegriff sein. Denkwürdig sind in diesem Zusammenhang die Formen einer kritischen Alternativstellung zur Emphase auf dem regionalen und nationalen Herkommen, die mit der ostentativen Umdeutung des Heimatbegriffs operieren: Meine Heimat ist die Sprache, sagt der habituell mobile Zeitgenosse, der Entwurzelte, Vertriebene, Verfolgte. Es war ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt gespielt hatte, sagt Hannah Arendt im Rückblick auf ihre unverstellte Bereitschaft, nach dem Ende des Dritten Reiches wieder nach Deutschland zu reisen. Der Ort des Künstlers ist die Kunst, sagt Thomas Bernhard in Abgrenzung gegen die Zumutung, seine Heimatstadt Salzburg als etwas Anderes denn einen Unort zu empfinden.
An Beispielen wie diesen lässt sich erahnen, wie die Erfahrung von Heimat ihre Zuflucht haben kann in der Paradoxie – indem sie ihre Angewiesenheit auf Erfüllung im kleinen Maßstab, ja selbst im flüchtigen Augenblick selbstbewusst einbekennt: eine Gruppe von Menschen, der Platz im Licht, ein Blick, ein Lied, eine glaubwürdige Maxime, ein gelingendes Gespräch können einstehen für das, was Heimat wäre. Wir sind nicht in der Welt, um es leicht zu haben.
Weiterführende Literatur:
„Transzendentale Heimatlosigkeit“ und „exzentrische Positionalität“. Ein kritischer Blick auf die Situation des (modernen) Menschen, in: Ulrich Hemel/Jürgen Manemann (Hg.): Heimat finden – Heimat erfinden. Politisch-philosophische Perspektiven, München (Wilhelm Fink-Verlag) 2017, 31-46.